Nazi-Glocken und NS-Kirchenbauten: „Oh du fröhliche“?
Mehr als tausend Kirchen wurden in der Nazizeit errichtet und umgestaltet. Die Symbole sind geblieben. Wie umgehen mit dem Erbe?

Doch hat man den Triumphbogen erreicht, predigen die gebrannten Platten eine Religion, die schaudern lässt. Lutherrosen, Christuskreuze und Abendmahlskelche wechseln sich ab mit Eisernen Kreuzen, Reichsadlern und den sehr entschlossen Gesichtern nordischer Männer. Dazwischen Kacheln, deren Medaillons leer sind. „Da waren die Hakenkreuze drin“, sagt Klaus Wirbel. In anderen Kacheln prangte das Zeichen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt NSU.
Elf Meter hoch spannt sich der Bogen und erzählt von Christi Blut und germanischem Boden, 800 gebrannte Reliefs, 36 wiederkehrende Motive, eine Botschaft: Das Evangelium hat in der Auferstehung des deutschen Volkes unter Adolf Hitler seine Erfüllung gefunden.
Und der Bogen ist nur die Ouvertüre. An der Kanzel steht Horst Wessel, den Arm um einen Hitlerjungen gelegt, und lauscht den Worten Jesu. Ein Wehrmachtssoldat faltet die Hände, eine deutsche Mutter ist auf die Knie gegangen. Und auf dem Altar hat sich der Gekreuzigte in einen muskelbepackten Arier verwandelt. Für Leni Riefenstahl eine Augenweide, aber für evangelische Christen? Wendet man sich um, wird man von einer Orgel erschlagen, die sich wie eine aufgehende Sonne erhebt. „Bevor die Orgel hier eingebaut wurde, hat sie 1935 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg gespielt“, hört man Klaus Wirbel reden. Das war der Parteitag, auf dem die „Rassengesetze“ beschlossen wurden, die Juden vollkommen entrechteten. Hitler selbst hatte eine Orgel gefordert. Und diese Orgel spielt demnächst „O du fröhliche“?
Klaus Wirbel, Kirchenexperte
Wer jetzt hinauswill, dem streckt sich im Vorraum ein Hindenburg-Gesicht wie eine Fratze entgegen, der Luther gegenüber kam erst nachträglich hinein. „Früher war da Hitler zu sehen.“ Fehlt nur noch, dass jetzt eine Hakenkreuzglocke bimmelt. „Die haben wir nicht“, sagt Wirbel, ein Kaufmann, der sein Leben lang bei der Bahn arbeitete. Es gab eine, allerdings wurde sie 1942 mit dem gesamten Geläut eingeschmolzen.
Eine Glocke aus dem Dörfchen Herxheim in der Pfalz erregte im vorigen Jahr Aufsehen, als bekannt wurde, dass darauf ein Hakenkreuz prangt. Soll man sie abhängen? Soll sie weiterläuten? Die Kirchengemeinde beratschlagte, der Bürgermeister redete sich um sein Amt, die Landeskirche schaltete sich ein, ebenso der Zentralrat der Juden. Die „Hitler-Glocke“ blieb hängen, in Zukunft aber soll sie schweigen.
Eine Glocke kann man abhängen. Aber eine Kirche? Soll man sie verrammeln? „Es gibt Pastoren, die weigern sich, hier zu predigen“, berichtet Wirbel. Der Bischof, so ist zu vernehmen, ist auch nicht erpicht, die Kirche zu betreten, und ein Gottesmann träumte davon, sie in die Luft zu jagen. Für den Kirchenhistoriker Hans Prolingheuer, der 2002 die Kirche und ihre Geschichte in einem Buch zu „Kirche und Kunst unterm Hakenkreuz“ beleuchtete, ist sie das erste „nationalsozialistische Gesamtkirchenkunstwerk“ und ein „protestantisches Schandmal“. Ein Schandmal, das sich nach jahrelanger Restaurierung in gutem Zustand präsentiert und unter Denkmalsschutz steht.
„In dem denkwürdigen Jahr 1933, dem ersten Jahr der Volkskanzlerschaft Adolf Hitlers, dem Jahr des gewaltigen Aufbruchs der deutschen Nation zu neuem nationalen Leben, legen wir heute, am 22. Oktober 1933, den Grundstein zu einer neuen Kirche“, steht in der Urkunde, die in einer Kapsel vermauert wird. Klaus Wirbel steht auf der Empore, hat die Chronik ausgebreitet. Beim Richtfest hat der Kreisleiter der „Deutschen Christen“ angesichts des Rohbaus eine Vision: Das Reich Gottes müsse in das Dritte Reich hineingebaut werden, dann werde Deutschland unüberwindlich sein. Zunächst aber baut sich die NS-Ideologie in die evangelische Kirche ein. Die neue „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ (DC) fühlt sich der Rassenlehre verpflichtet, lehnt das Alte Testament ab, predigt einen „bejahenden artgemäßen Christusglauben“ und baut an einer Reichskirche für „arische“ Christen.
Künstler verarbeiten für Mariendorf deutsche Eichen und deutsche Erde zur neuen deutschen Kirchenkunst. Am 22. Dezember 1935 wird der Bau geweiht. Erstaunlich, dass die Posaunen vom Turm aus „Tochter Zion, freue dich“ spielen, ein Adventslied, das wegen seiner jüdischen Anklänge mit der „Entjudung“ der Kirchenmusik bald aus den Liederbüchern verschwindet. „Tochter Zion“ war 1935 noch möglich. Nicht alles war so eindeutig, wie es heute scheint, ist Klaus Wirbel überzeugt. Die Gemeinde war nicht völlig von deutschen Christen erobert, glaubt er. Trotzdem schließen die Protokolle des Gemeindekirchenrats stets mit „Heil Hitler!“.
Manches, was Wirbel sagt, klingt nach Rechtfertigung, wie er in so einer Kirche singen und beten kann. Wirbel führt prominenten Beistand an. „Für mich ist wichtig, dass Jochen Klepper hier war.“ Der Theologe, Journalist und Schriftsteller war mit einem der Gemeindepfarrer befreundet, erzählt Wirbel. Im Dezember 1938 geht Klepper mit seiner Frau Johanna in die Kirche, wo der Pfarrer Kleppers Frau, nach den Rassegesetzen eine „Volljüdin“, tauft und das Paar kirchlich traut – Amtshandlungen, die längst nicht mehr jeder Pastor an „Mischehen“ vollzieht.
Offensichtlich findet Klepper im Umfeld der Blut-und-Boden-Kirche Halt, jedenfalls eine Zeit lang. In Erwartung von Zwangsscheidung und Deportation nehmen sich Jochen und Johanna Klepper und deren Tochter in der Nacht zum 11. Dezember 1942 das Leben. Klepper hinterlässt Romane, Tagebücher, Manuskripte und die Liedersammlung „Kyrie“. Zwölf Lieder daraus finden sich heute im evangelischen Gesangbuch, Kleppers berühmtestes ist „Die Nacht ist vorgedrungen“, ein Lied für den Advent.
Und noch etwas ist Wirbel wichtig: Neben dem Altar ragt ein Nagelkreuz aus der Kathedrale von Coventry, die im November 1940 von der deutschen Luftwaffe zerstört wurde. Das Kreuz, inzwischen weltweit verbreitet und Symbol für Frieden und Versöhnung, mag wie ein Gegengift wirken. Wichtiger aber sind die Tafeln, die erklären, was es mit der Kirche auf sich hat. Einmal ist bei Wirbel so etwas wie Erleichterung herauszuhören. „Es gab Sorgen, dass das ein Pilgerort für Neonazis wird. Dazu ist die Kirche aber wohl zu unbedeutend.“
Manfred Hojczyk, Pfarrer, über den nordischen Christus in der Strasburger Marienkirche
Die Martin-Luther-Gedächtniskirche ist keineswegs ein Einzelstück. Mehr als tausend Kirchen und Gemeindehäuser wurden zwischen 1933 und 1944 errichtet, umgestaltet, erneuert. Großzügig förderte das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung die Sakralbauten und vermittelte Aufträge an damals untadelige Künstler, Günther Martin etwa. Über dessen Großplastiken bemerkte ein Kritiker, dass sie aussehen „wie Vertreter eines Willens zum Endgültigen“.
Im Städtchen Strasburg in der Uckermark lässt sich das überprüfen. Pfarrer Hojczyk hat die Marienkirche aufgeschlossen und steht vor einem 2,70 Meter hohen Christus, der normal Sterbliche sofort zu Zwergen werden lässt. Die erhobenen Hände verstärken das noch. Mit der rechten leistet er einen Schwur und mit der linken? „Einen Hitlergruß? Nein, also…“ Manfred Hojczyk ist kurzzeitig entgeistert, so unglaublich erscheint ihm, was er gerade gehört hat. Dass der „Auferstehende“ von Günther Martin ein überragendes Zeugnis der NS-Kirchenkunst darstellt, weiß Hojczyk natürlich. Solche ernsten Gesichter finden sich in jener Zeit oft auf Werbeplakaten für die Waffen-SS. Aber einen, zumindest angedeuteten Hitlergruß, wie manche Historiker behaupten?
Kaum Zeit für den nordischen Heiland
Hojczyk, seit zehn Jahren Pfarrer in Strasburg, ist ein freundlicher Arbeiter in Gottes Weinberg, Herr über sieben Kirchen, Prediger, Sachwalter über eine Vielzahl von Aufgaben: Seniorennachmittage, Kindergarten, Posaunenchor, Bibelkreis, dazu Fürsprecher einer Flüchtlingsfamilie aus dem Iran. Allzu viel Zeit hat Hojczyk noch nicht gehabt für den nordischen Heiland. „Die Pastoren waren Leute der Bekennenden Kirche“, behauptet Hojczyk. Die Bekennende Kirche war eine Gegenbewegung zu den Deutschen Christen, die gegen die Gleichschaltung der evangelischen Kirche kämpfte und in einem 1934 formulierten Bekenntnis Hitlers Totalitätsanspruch zurückwies. Warum aber ausgerechnet Strasburg kunstpolitisch so privilegiert wurde? Hojczyk, in Strickpullover und Mantel gehüllt, zuckt mit den Schultern.
Curt Steinberg, NSDAP-Genosse und Architekt zahlreicher Kirchen, darunter der Martin-Luther-Gedächtniskirche, bekam 1935 den Auftrag, St. Marien in Strasburg dem Geiste der Zeit anzupassen, gefördert mit Mitteln des preußischen Ministerium für Volksbildung. Neben einem Kirchenmaler beschäftigt er den Berliner Bildhauer Günther Martin, ebenfalls Parteigenosse und rühriger Leiter der Ateliergemeinschaft Klosterstraße in Berlin. Martin, Jahrgang 1896, schuf nicht nur eine Skulptur, sondern auch eine Kanzel, ganz ähnlich der in Berlin-Mariendorf. Aber die deutsche Volksgemeinschaft ist in die Sakristei abgeschoben. Die Holztafeln stehen verstreut, der Sämann, der Arbeiter, der Pfarrer. Die Kanzel wird nie aufgebaut, der nordische Christus aber kommt 1938 auf den Altar. „Es ist ja ungewöhnlich, dass ein Sieger zu sehen ist“, sagt Hojczyk. „Im Altarraum sieht man sonst eher den Gekreuzigten.“
Die Zeit der Herrenmenschen war 1945 vorbei. „Die Gemeinde hat sich entschieden, ihn wegzunehmen.“ Wann genau? Hojczyk winkt ab. Man müsste im Archiv suchen. Irgendwann jedenfalls hat die Gemeinde ihren Heros unter den Gefallenentafeln diverser Kriege mit Eichenlaub und Eisernen Kreuzen versteckt. So steht er da, schwört und grüßt die leeren Bänke.
Was mit ihm werden soll? „Ich bin gegen Bilderstürmerei“, sagt Hojczyk vorsichtig. Gelegentlich sei der Auferstandene schon Thema gewesen, „nicht in der Gemeinde, aber im Gemeindekirchenrat.“ Wäre es nicht sinnvoll, zumindest eine Tafel aufzustellen, die dieses Kunstwerk einordnet, so wie in Berlin? „Ich habe nicht viel, was ich draufschreiben könnte.“ Hojczyks Stimme verhallt unter dem mächtigen Gewölbe. Vielleicht gibt es ja Unterstützung bei der Landeskirche? Ja, vielleicht, murmelt Hojczyk. Seine Nordkirche ist ein geografisches Ungetüm mit der Zentrale in Kiel, vier Autostunden von hier. Man kann sich mit diesem „artgemäßen“ Christus schon ziemlich verlassen vorkommen.
Immerhin hat die evangelische Kirche Berlin – Brandenburg – schlesische Oberlausitz (EKBO) ein Heft „Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit“ herausgegeben. Auf dreißig Seiten sind Grundsätze zusammengefasst, wie mit dem kulturellen Erbe, insbesondere dem der beiden deutschen Diktaturen, umgegangen werden soll. Es geht um pädagogische Konzepte, ehrenamtliches Engagement und letztlich darum, wie Hakenkreuzglocken, arische Christus-Figuren und völkische Kanzelreliefs in die Erinnerungsarbeit einbezogen werden.
Für die Martin-Luther-Gedächtniskirche soll es nach mehreren gescheiterten Versuchen ein tragfähiges Konzept geben. Marion Gardei, in der EKBO Beauftragte für die Erinnerungskultur, ist Mitverfasserin der kleinen Broschüre. Ihr schwebt ein Lern- und Gedenkort vor, ein Raum, der für Ausstellungen und Veranstaltungen über Kirche im Nationalsozialismus genutzt wird und die NS-Kunst entsprechend einbezieht. Das Bauwerk bietet eine „große pädagogische Chance“.

Erinnerungsorte schaffen
Doch es gibt nicht nur die repräsentative NS-Kirchenkunst. In Dorf- und Stadtkirchen fanden und finden sich versteckte Zeugnisse, mal ein Hakenkreuz zwischen Bauernmalerei an der Kirchendecke, mal ein Hakenkreuz auf der Wetterfahne, dann Führerkult auf Glocke, Hitler-Eichen vor der Kirche. Die Kehrseite gibt es auch. So wurde auf Kanzeln und Altären der alttestamentliche Gottesname JHWH übermalt, „Entjudung“ mittels Farbe und Pinsel. Solche Belege protestantischen Furors können immer auch Anlass sein, kleine Erinnerungsorte zu schaffen, ist Gardei überzeugt.
Manches läuft schon vorbildlich. Als im vorigen Jahr öffentlich wurde, dass in der kleinen Wichernkirche in Berlin-Spandau eine Glocke mit Hakenkreuz läutet, hat die Gemeinde schnell reagiert. Was für manche ein offenes Geheimnis darstellte, war für andere einen Schock. Seitdem ich weiß, was es mit der Glocke auf sich hat, ertrage ich ihr Läuten nicht mehr, hat eine Frau auf der Gemeindeversammlung bekannt. Im Dezember 2017 wurde die Glocke gegen eine neue ausgetauscht. Derzeit steht die alte im Keller eines Gemeindehauses, das Hakenkreuz, Kantenlänge 8,5 Zentimeter, wurde nach dem Guss hineingeschnitten. Eine Arbeitsgruppe hat das Gemeindearchiv durchforstet, ein Historiker arbeitet die Geschichte der Glocke auf. 2019 soll sie als Dauerleihgabe im stadtgeschichtlichen Museum Spandau ausgestellt werden, schweigend, aber nicht wortlos. Was will man mehr?
Vielleicht, dass der Blick sich schärft. NS-Einflüsse finden sich nicht nur in Kirchen. 1941 erscheint zum ersten Mal „Schild des Glaubens“, ein biblisches Lesebuch für Kinder. Jörg Erb, Lehrer und seit 1933 in der NSDAP, stellt das Buch zusammen, die Grafikerin Paula Jordan steuert die Illustrationen bei. Da wandert Jesus mit rasiertem Kinn, halblangem glatten Haar und nordischem Gesicht durch das Heilige Land, die Jünger bilden die Volksgemeinschaft, die Kinder wirken wie Jungvolk. Einzig die Pharisäer, die Jesus nach dem Leben trachten, sind Juden, so wie sie der Stürmer beschreibt – verschlagen, hochmütig und hinterhältig. Jordan hat ganz im Stile ihrer Zeit gezeichnet – rassisch einwandfrei.
Die richtige Karriere beginnt für das Lesebuch aber erst nach dem Krieg. Das Buch ist nicht nur in der Bundesrepublik ein Bestseller, auch in der DDR, wo es das maßgebliche Buch für die evangelische Christenlehre wird. Die Zeichnungen von Paula Jordan prägen so die biblische Vorstellungswelt ganzer Generationen von Kindern. Erst 1993 erscheint die letzte Ausgabe, es ist die sechzigste. Insgesamt werden 1,6 Millionen Exemplare verkauft.
Zeichnungen von Paula Jordan finden sich heute noch in Kinderbibeln. Populär ist ihre Weihnachtskrippe im Holzrahmen und auf Transparentpapier. Derzeit dürfte sie wieder in vielen Wohnzimmern Besinnlichkeit verbreiten. In Berlin-Mitte, in der Missionsbuchhandlung unweit des Alexanderplatzes, erleuchtet ein Exemplar das Schaufenster. Maria, Josef und das Jesuskind – eine deutsche Familie unter einem nordischen Engel, evangelisches Traditionsgut für 34,90 Euro. Vorsichtig hebt die Buchhändlerin die Krippe aus der Auslage, klappt sie auf und betrachtet lange die Szenerie. Nach einer Weile sagt sie, mehr zu sich selbst: „Wie vor achtzig Jahren.“ Und es klingt gar nicht erschrocken, sondern beseelt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










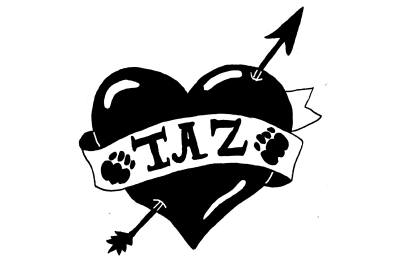
meistkommentiert
Krieg in der Ukraine
Die Ukraine muss sich auf Gebietsverluste einstellen
Schicksal vom Bündnis Sahra Wagenknecht
Vielleicht werden wir das BSW schon bald vermissen
Gedenken an Kriegsende in Torgau
Kretschmers Botschaft an Russlands Botschafter
Tesla „Nazi-Auto“
Berlins Arbeitssenatorin legt nach
„Friedensplan“ für die Ukraine
Auch Worte aus Washington töten
Demonstration für Lorenz A.
Eine Stadt trauert