Insektensterben in Deutschland: Weg mit dem englischen Rasen
Naturschützer formulieren einen Appell gegen das Insektensterben. Darin fordern sie mehr Geld für den Artenschutz und eine Pestizidabgabe.
Deutlich mehr Geld für den Artenschutz, mehr Forschung und ein strikterer Umgang mit Pestiziden – das sind die Kernforderungen des „Münsteraner Appells zum Insektenschutz und zur Erhaltung der Biodiversität“, der am Wochenende auf einer Tagung des Naturschutzbundes Nabu im westfälischen Münster aufgesetzt wurde.
So fordert der Nabu, das Bundesprogramm Biologische Vielfalt von den im Jahr 2018 bislang vorgesehenen 25 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro zu verdoppeln. Mit dem Programm sollen überregional bedeutsame Artenschutzprojekte gefördert werden. Zudem brauche man einen neuen Fördertopf, die „Gemeinschaftsaufgabe Biologische Vielfalt“, ausgestattet mit 100 Millionen Euro jährlich. Ackergifte will der Nabu verteuern: Im „Münsteraner Appell“ schlägt er vor, „externe Kosten wie Gesundheits- und Umweltschäden“ durch die Einführung einer Pestizidabgabe in die Preisgestaltung von Pestiziden aufzunehmen.
In privaten Gärten möchten die Naturschützer Pestizide ganz verboten sehen; auf öffentlichen Grünflächen hingegen sollte ein „insektenfreundliches Pflegeregime“ herrschen – also blühende Wiesen statt englischem Rasen.
Abgesehen von diesen konkreten Maßnahmen fordert der Nabu mehr Forschung. Die Ursachen für den dramatischen Insektenrückgang seien nicht eindeutig geklärt, sagte Josef Tumbrinck, Vorsitzender des Nabu NRW, in Münster. Darum sei es wichtig, mehr Grundlagenwissen zu erlangen, um Rückschlüsse auf die Auswirkungen verschiedener Landnutzungsformen und Einflüsse auf die Insektenvielfalt ziehen zu können.
Nistgelegenheiten oder Blühflächen
Die großen Wissenslücken in dem Bereich rückte Christian Maus, Wissenschaftlicher Leiter des Bayer Bee Care Centers, in den Mittelpunkt seines Vortrages auf der Tagung. Zwar halte der Leverkusener Chemiekonzern es „unter Berücksichtigung der bereits verfügbaren Daten“ für „sehr wahrscheinlich, dass ein Rückgang der Insekten in den letzten Jahren tatsächlich stattgefunden hat“.
Allerdings unterstützten die vorliegenden Daten nicht die Hypothese, dass der „Pflanzenschutz eine Schlüsselrolle für die Rückgänge spielt“, so Maus. Insofern seien neben der weiteren wissenschaftlichen Analyse und einem umfangreichen Insektenmonitoring vor allem Maßnahmen auf Landschaftsebene geeignet, um Insekten zu schützen – also etwa Nistgelegenheiten oder Blühflächen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







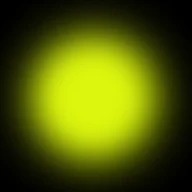


meistkommentiert