Die USA nach dem Super Tuesday: Das Comeback-Kid
Niemand gab mehr einen Pfifferling auf Joe Bidens Kandidatur bei den US-Demokraten. Nun ist der 77-Jährige ernsthafter Konkurrent für Sanders.
E s waren fünfzig Stunden, die die Stimmung an der Demokraten-Basis verändern sollten. Zwischen der Schließung der Wahllokale in South Carolina am Samstagabend und der Öffnung der Wahllokale in 14 Bundesstaaten und einem Territorium am Super Tuesday mobilisierte die Demokratische Partei ihre komplette Nomenklatura für einen Mann, der nur Tage zuvor politisch totgesagt worden war.
Die Operation Joe Biden ging mit der Präzision eines Uhrwerks und mit der Wucht einer Dampfwalze über das Land. Sie wurde aus sämtlichen Zentren der demokratischen Macht gefüttert. Alle paar Minuten erschien eine neue Unterstützungserklärung. Zentristische Präsidentschaftskandidaten beendeten reihenweise ihre eigenen Kampagnen, um Joe Biden nun endlich den Vortritt zu lassen.
Gouverneure, Senatoren, Abgeordnete und Bürgermeister der Partei – insgesamt 1.500 an der Zahl – wussten in den Stunden vor dem Super Tuesday plötzlich mit ultimativer Sicherheit, dass Joe Biden ihr Mann war. Einer nach dem anderen erklärten sie: „Biden for President“. Und kündigten ihr eigenes Engagement an seiner Seite an.
Spät in der Nacht zum Mittwoch stand fest, dass es geklappt hatte. Biden stand in Los Angeles an einem Mikrofon, breitete die Arme aus und setzte an zu einer Siegesrede. Sein Sakko war schief geknöpft. Er wirkte wie so oft verloren und unkonzentriert. Stand wie ein Unbeteiligter dabei, als mehrere Demonstrantinnen die Bühne stürmten und von dort verdrängt wurden. Und begann mit einem seiner legendären Fauxpas. „Dies ist meine kleine Schwester“, sagte er, als er nach der Hand seiner Frau griff, die neben ihm stand. Die Schwester rahmte ihn auf der anderen Seite ein.
„Leute, es sieht verdammt gut aus“, rief Biden nach den höflichen Lachern aus dem Publikum in das Mikrofon. Dann richtete er sich an „jene, die niedergeschlagen, ausgezählt und zurückgelassen wurden“. Ihnen widme er seine Kampagne. Zugleich erinnerte der 77-Jährige mit diesen Worten an seinen eigenen langjährigen Ruf als Comeback-Kid.
In einer atemberaubenden Wende bei den demokratischen Vorwahlen hat Biden Siege in zehn Bundesstaaten davongetragen. Nachdem er schon am Samstag South Carolina haushoch gewonnen hatte, räumte er am Super Tuesday Staaten quer durch die USA ab – von Neuengland über den Süden bis nach Texas. Er etablierte sich damit als Favorit des Rennens.
Es war ein triumphaler Tag für Biden. Aber während er seinen Unterstützern dankte, tröpfelte der Beifall aus der Menge nur höflich.
Wenige Stunden zuvor hatte am anderen Ende der USA, in Vermont, der demokratische Sozialist Bernie Sanders seine Super-Tuesday-Rede gehalten. Er sprach in Burlington, Vermont, der Stadt, in der er 31 Jahre zuvor seine politische Karriere mit seiner ersten Wahl zum Bürgermeister begonnen hatte. In seiner von jubelnden Anhängern unterbrochenen Rede ging es um höhere Mindestlöhne und härtere Besteuerung von Spitzenverdienern, um die Definition von Krankenversicherung „als Menschenrecht und nicht als Privileg“ und um die Abschaffung von Studiengebühren.
Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Michael Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten auf. Bloomberg erklärte seinen Rückzug am Mittwoch in einer Mail an seine Anhänger und sprach Ex-US-Vizepräsident Joe Biden offiziell seine Unterstützung aus. Nach dem „Super Tuesday“ bestehe für ihn rein rechnerisch keine Chance mehr, sich die Nominierung zu sichern. Der richtige Kandidat sei Biden. (dpa)
Auch Bernie Sanders erklärte, „wir werden gewinnen“. Aber für ihn war der Super Tuesday viel härter verlaufen als erwartet. Er gewann nur vier Bundesstaaten. Darunter ist zwar aller Wahrscheinlichkeit nach Kalifornien, die größte Trophäe, mit Hunderten von Delegierten. Aber Sanders schaffte in keinem der Staaten mit starken afroamerikanischen Bevölkerungsgruppen den Durchbruch. Er verlor Oklahoma und Minnesota. Und er verfehlte Texas, wo er noch wenige Tage zuvor als wahrscheinlicher Sieger erschienen war.
Anders als Joe Biden erwähnte der 78-jährige Bernie Sanders in seiner Ansprache nicht jene, die ihn unterstützt hatten, sondern jene, die sich gegen ihn und seine Kampagne stemmen, „das politische und das unternehmerische Establishment, die Gier der Wall Street, von Pharmakonzernen, Versicherungen und Minderalölindustrie“. Es war seine Art, die Basis auf härtere Auseinandersetzungen und mächtigere Gegner einzustimmen.
Der Super Tuesday hat die Karten in dem demokratischen Präsidentschaftswahlkampf neu gemischt. Im Jahr 2019 hatte die Kampagne als die diverseste in der Geschichte der USA begonnen. Mehr als zwei Dutzend Teilnehmer kamen ins Rennen um die Nachfolge von Donald Trump. Unter ihnen waren besonders viele Frauen und Repräsentanten aus der afroamerikanischen-, der latino- und der asiatischen Bevölkerung sowie der schwule Ex-Bürgermeister einer Kleinstadt. Anfang März 2020 ist von der Vielfalt nichts und niemand mehr übrig.
Am Morgen nach dem Super Tuesday steht fest, dass der Rest dieses demokratischen Vorwahlkampfs und der Weg zum Nominierungsparteitag im Juli in Milwaukee ein Duell zwischen zwei fast gleichaltrigen weißen Männern sein wird. Doch trotz dieses vermeintlich ähnlichen Erscheinungsbildes repräsentieren die beiden starke Unterschiede. Zwischen Biden und Sanders verläuft der tiefe ideologische Graben zwischen Bewahrern und Erneuerern, der die Demokraten seit Jahren spaltet. Ihr nun beginnendes Duell erinnert an eine Neuauflage der Konstellation von 2016 – mit dem Unterschied, dass dieses Mal Biden in die Rolle von Hillary Clinton geschlüpft ist. Und dass Sanders heute bekannter und beliebter ist als noch vier Jahre zuvor.
Sanders hat seine Fans in den zurückliegenden Monaten immer wieder gewarnt, dass die „politische Revolution“ zahlreiche mächtige Gegenspieler habe. Er kündigte harten Gegenwind und Niederlagen an. „Wir werden nicht immer gewinnen“, mahnte er noch am Samstagabend, nachdem Biden seinen allerersten Primary-Wahlkampf in South Carolina eingefahren hatte.
Dampfwalze gegen Sanders
Doch auf die Wucht der Dampfwalze, mit der die Demokratische Partei über die Super-Tuesday-Staaten gerollt ist, war die Kampagne von Sanders nicht vorbereitet. Die großen und kleinen Unterschiede, über die die Kandidaten Klobuchar und Biden sowie O’Rourke und Buttigieg mit Tausenden von Wählern über Wochen diskutiert hatten, sie waren plötzlich nicht mehr wichtig. Stattdessen verbündeten sich alle Beteiligen für ein gemeinsames Ziel: Sanders’ Wahlsieg zu verhindern.
Das Vorbild für dieses Vorgehen lieferte South Carolina. Dort schwieg der führende schwarze Demokrat Jim Clyburn, der seit Jahrzehnten im US-Repräsentantenhaus sitzt und in dem Bundesstaat als Königsmacher gilt, bis zwei Tage vor dem Super Tuesday. Dann rief er ohne jedes Wenn und Aber zur Wahl von Biden auf. In South Carolina, wo die Mehrheit der demokratischen Wähler schwarz sind und wo bis dahin ein großer Teil von ihnen unentschieden war, machte sein Engagement den Unterschied.
In den Stunden nach den Vorwahlen in South Carolina hat die Demokratische Partei dieses Modell quer durch die Vereinigten Staaten eingesetzt. Das „Establishment“, wie Bernie Sanders es nennt, zeigte, wozu es fähig ist. Die Zentristen waren dabei so erfolgreich, dass Biden selbst Bundesstaaten gewann, in denen er nicht über eigene Wahlkampfbüros verfügte und in denen er nie größere Auftritte veranstaltet hat.

Auch die Sanders-Kampagne legte in den Tagen vor dem Super Tuesday zu. Auch sie erweiterte ihre Basis. Auch sie erhielt Unterstützung: von Klimaorganisationen, von Einwanderergruppen und von Gewerkschaftern. Zusätzlich klopften Sanders’ Leute an mehr Haustüren und riefen bei mehr Wählern an als die Unterstützer jedes anderen Kandidaten. Bei Wahlkampfveranstaltungen in Stadien und Parks in Texas, Massachusetts, Utah und Kalifornien jubelten Tausende junge Leute Sanders zu.
Aber Sanders Basis aus mehrheitlich jungen Aktivisten, von Freiwilligen, die zwar den Enthusiasmus und die Erfahrung von drei Jahren Opposition gegen Donald Trump mitbringen, und die gelernt hat, die sozialen Medien meisterhaft zu nutzen, schaffte es in den entscheidenden Stunden zwischen South Carolina und dem Super Tuesday nicht, dem Apparat der Demokratischen Partei die Stirn zu bieten.
Noch ist nichts entschieden
Joe Biden verfügt nun über 453 Delegierte gegenüber 382 für Sanders. Damit liegt Biden noch weit unter der für eine Nominierung nötigen Mehrheit von 1.991 Stimmen. Das letzte Wort über den Kandidaten, der im November Donald Trump herausfordern wird, ist noch nicht gefallen. An den beiden kommenden Dienstagen in diesem Monat finden weitere Primaries statt. Und noch bis Mitte April laufen Vorwahlen in Bundesstaaten, die Hunderte von Delegierten zu vergeben haben, darunter auch New York.
Die Auseinandersetzungen zwischen Biden und Sanders, die sich bei Debatten gegenseitig als „mein Freund“ bezeichnen und die seit Jahrzehnten in Washington unterschiedliche Positionen vertreten, werden sich nun zuspitzen. Als Argumentationshilfe hat die Sanders-Kampagne Ratgeber an ihre Basis verteilt. Die großen Themen darin sind die Unterschiede zwischen den beiden Männern.
Ganz oben steht die Erweiterung der Sozialversicherung, das zugleich beliebteste und am stärksten angefeindete Regierungsprogramm. Trump, wie üblich unterstützt von dem republikanischen Chef des Senats, Mitch McConnell, hat für die nächste Legislaturperiode Einschnitte in diese Sozialversicherung angekündigt. Biden hat im Laufe seiner langen Karriere in Washington vielfach solche Schritte befürwortet. Ein anderes Thema, das die Kampagne Sanders nun einsetzen will, ist der Handel. Biden, so die Argumentation, sei für all jene Abkommen wie den nordamerikanischen Freihandel bis zum China-Deal eingetreten, die in den USA Millionen von Arbeitsplätzen gekostet hätten. Sanders lehnte diese Freihandelsabkommen schon immer ab.
Das dritte und zugleich komplexeste Thema für die kommenden Auseinandersetzungen zwischen Biden und Sanders wird die Krankenversicherung werden. Biden ist – als ehemaliger Vizepräsident unter Barack Obama – mitverantwortlich für die Gesundheitsreform. Sie ist populär, weil sie Millionen von zuvor nicht Versicherten Zugang zu einem Krankenschutz verschafft hat. Und sie ist zugleich unpopulär, weil immer noch viele Millionen Menschen gar nicht oder unterversichert sind, und weil die Reform nichts an den hohen Kosten im Gesundheitswesen geändert hat. Biden will an privaten Krankenversicherungen festhalten. Sanders hingegen propagiert eine staatliche Krankenversicherung für alle. Seine Kampagne wird unter anderem damit argumentieren, dass die Profiteure des privaten Gesundheitssystems – die Versicherungen, die Pharmaindustrie und die privaten Kliniken und Medizingerätehersteller – zu den stärksten Finanziers von Bidens Kampagne gehören.
Schlammschlacht droht
Jenseits dieser Themen werden die beiden Männer auch über ihre Vita streiten. Biden und seine Unterstützer werden versuchen, Sanders als „zu links“ und „zu radikal“ für die USA zu disqualifizieren. Sie werden darauf beharren, dass Sanders eine Sympathie für Diktatoren wie Fidel Castro habe. Und sie werden auf sein Engagement für die Sandinisten in Nicaragua und andere linke Bewegungen in aller Welt verweisen. Umgekehrt sind zahlreiche Momente aus Bidens Leben bekannt, die ihn angreifbar machen. Eines erzählt von seinem Sohn Hunter, der ein Spitzeneinkommen im Aufsichtsrat eines ukrainischen Energiekonzerns verdiente, während sein Vater als US-Vizepräsident die Korruption in der Ukraine bekämpfte.
Sanders selbst hat in seinem politischen Leben auf Negativkampagnen verzichtet. Er hat auch dieses Mal kein einziges Negativ-Video in Umlauf gebracht.
Doch dafür sorgt schon Donald Trump. Er wird jeden beliebigen demokratischen Herausforderer als „gefährlichen“ und „radikalen Sozialisten“ bezeichnen. So hat er es auch schon im Jahr 2016 mit Hillary Clinton gehalten. Zusätzlich ist zu erwarten, dass der US-Präsident auch seine im letzten Wahlkampf erprobten Schmierenkampagnen ausweiten wird. Die Slogans, zu denen er seine Basis bei jedem neuen Auftritt ermunterte – von „sperrt sie ein“ über „krumme Hillary“ bis hin zu „wo sind die E-Mails“ – haben tiefe Spuren in den Köpfen hinterlassen – und das nicht nur bei Wählern der Republikanischen Partei.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









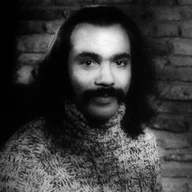


meistkommentiert