Antisemitismus in Frankreich: Wann, wenn nicht jetzt
Delphine Horvilleur, eine wichtige französische Intellektuelle und Leitfigur des liberalen Judentums, über den historischen Wendepunkt und Folgen des wachsenden Antisemitismus.
Dies ist die Geschichte von zwei Juden, die die Zeitung lesen. Der eine sagt zum anderen: „Spanien hat Argentinien gestern Abend in einem Spiel mit 2:1 besiegt.“ Und der andere antwortet ihm: „Ist das gut für die Juden?“
„Ist das gut für die Juden?“ Wenn meine Großeltern oder meine Eltern diese Worte aussprachen, ging es natürlich immer um Politik oder Wahlen. Sie fragten, welche Auswirkungen dieser oder jener politische Moment auf uns Juden haben könnte. Als Kind fand ich das grotesk, absurd und sogar ziemlich nervig, als ob die gesamte Politik einer Nation auf die Zukunft der Juden, ihr Wohlergehen oder Unglück reduziert oder daran gemessen würde.
Natürlich war ich nicht reif genug, um die tiefere Bedeutung dieser Fragestellung zu verstehen. Ich konnte zwischen diesen Worten nicht das Gewicht der Geschichte, der Erfahrung und so vieler Traumata wahrnehmen, das Bewusstsein, dass sich die Juden in der Vergangenheit so oft auf seltsame Weise im Gleichgewicht oder im Ungleichgewicht politischer Umschwünge wiederfanden, gegen ihren Willen instrumentalisiert, wie Schachfiguren in Wahlkämpfen manipuliert.
So oft wurde in der Geschichte versprochen, sie zu schützen, oder gefordert, sich vor ihnen zu schützen, ihnen zu helfen oder sie im Stich zu lassen …
Rückkehr in die Geschichte
Delphine Horvilleur
geb. 1974, Rabbinerin des Mouvement juif libéral de France und Chefredakteurin der Zeitschrift „Tenou’a“. Sie lebt in Paris. Zuletzt erschien von ihr auf Deutsch „Mit den Toten leben“ (Hanser). Demnächst erscheint ihr neues Buch über den 7. Oktober und die Folgen. Die hier dokumentierte Rede hielt Delphine Horvilleur als Drascha zum Schabbat vor den französischen Parlamentswahlen des 30. Juni 2024.
Foto: Lou Benoist/afp
Und nun habe ich seltsamerweise das Gefühl, dass wir genau dorthin zurückkehren, in diese Zeit der Geschichte. In den letzten Wochen höre ich die Stimmen meiner Großeltern in meinem Kopf widerhallen. Auf absurde und verwirrende Weise drehen sich heute so viele französische Debatten um uns. Es geht um den Platz der Juden, ihre Sicherheit oder ihre tiefe Unsicherheit, um das Versprechen der einen oder anderen Seite: „juré, craché, on n’est pas du tout antisemites“ oder „juré, craché on n’est plus du tout antisemites“ (wir sind keine Antisemiten).
Und inmitten all dessen ein 1.000-prozentiger Anstieg der Angriffe auf Juden, die Not so vieler von uns und unsere Angst, die uns dazu bringt, so viele verwirrende Optionen in Betracht zu ziehen und manchmal, zugegebenermaßen, auch ein bisschen Mist zu reden.
Wie oft habe ich in den letzten zwei Wochen den gleichen Satz gehört oder die gleiche Botschaft erhalten? „Für wen werden Sie stimmen?“ Ich verstehe nie, ob dieses „Sie“ an mich persönlich gerichtet ist, mit der üblichen Anrede, oder ob mein Gesprächspartner mich tatsächlich nach der „jüdischen Wahl“ fragt – als ob es so etwas gäbe.
Als ob Juden wie ein einziger Mann und eine einzige Frau wählen würden, als ob ihre Stimme sich von Natur aus vom Rest der Nation unterscheiden würde, als ob das sogenannte „auserwählte Volk“ eine Art Superwähler wäre, der die Fähigkeit hätte, das Ergebnis einer Wahl zu bestimmen oder zu überbeeinflussen.
Die Zukunft einer Katastrophe
Ich habe letzte Woche eine ganze Reihe von Nachrichten von Leuten erhalten, die mir „wohlwollend“ mitteilten, dass, wenn diese oder jene Partei die Wahlen gewinnen würde, es „unsere Schuld“ sei, die von uns Juden. Mit unseren 0,6 Prozent der Bevölkerung wäre unsere Mikro-Stimme zwangsläufig für die Zukunft einer Katastrophe verantwortlich. Wir hätten diese Fähigkeit, die Geschichte in die eine oder andere Richtung zu lenken.
Was daran so erstaunlich ist? Es ist allgemein bekannt, vor allem unter Antisemiten, dass die Juden die Welt, die Politik, die Banken und die Finanzwelt manipulieren.
Wir befinden uns in einem Schraubstock, in dem wir von politischen Vorschlägen erdrückt werden, die wahlweise unser familiäres oder republikanisches Erbe verletzen, während in uns so viel jüdischer und französischer, französischer und jüdischer Schmerz geweckt wird.
Die Weisheit Hillels
Lassen Sie mich einen Spruch von Hillel, dem berühmten Weisen aus dem Talmud, erwähnen, der in Debatten zwischen Rabbinern am Ende immer oder fast immer die Oberhand gewinnt.
Es wird erzählt, dass die beiden großen Weisen Hillel und Schammai sich immer stritten, über jedes Thema oder fast jedes Detail des Gesetzes … und dass in Wirklichkeit beide recht hatten. Dass jede ihrer Meinungen gerechtfertigt werden konnte. Dennoch gewann Hillel immer die Oberhand, und der Talmud fragt sich, warum. Warum gewann er die Debatte, obwohl Schammai nicht im Unrecht war?
Die Antwort des Talmuds: Im Gegensatz zu Schammai war Hillel in der Lage, die Argumente seiner Gegner vor seinen eigenen zu zitieren und dann seinen Standpunkt zu verteidigen. Hillels Standpunkt gewinnt, nicht weil er gültiger ist, sondern weil er dem anderen wirklich zuhört, sich für einen Moment in seine Lage versetzt und dann einen anderen Standpunkt vertritt.
Ist es nicht genau das, was unserer Gesellschaft nicht mehr gelingt, sich einen Moment lang in die Lage des anderen zu versetzen? Es ist, als würde jeder nur auf die Grundlage seines eigenen Standpunkts hören und die Erfahrung des Gegenübers verleugnen.
Was bin ich?
Doch zurück zu Hillel, dem Weisen. Die Tradition sagt ihm einen Spruch nach, eine Art geheimnisvolles „Triptychon“, das wahrscheinlich der berühmteste Satz ist, den er je gesagt hat.
Diesen Satz kenne ich seit Ewigkeiten, ich habe ihn tausendmal wiederholt, aber letzte Woche dachte ich, dass ich ihn in Wirklichkeit nie richtig verstanden habe. Plötzlich höre ich ihn wie zum ersten Mal, als ob seine Botschaft heute auf völlig neue Weise widerhallen würde:
„Wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich? Wenn ich nur für mich bin, was bin ich? Und wenn nicht jetzt, wann dann?“
Hillel stellt drei Fragen, er antwortet auf keine. Er scheint wie wir in einer Situation des Zweifels zu sein. Er hat keine Antwort, aber er formuliert drei relevante Fragen.
Politische Dringlichkeit
Beginnen wir mit der dritten: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Hillel erzählt uns von der Dringlichkeit, natürlich ist es die politische Dringlichkeit. Wir können uns nie den Luxus leisten, unsere Entscheidungen aufzuschieben. In jeder Generation werden wir, ob es uns gefällt oder nicht, aufgefordert, die Notwendigkeit unseres politischen Handelns zu erkennen, über unseren Platz in der Gesellschaft, in der wir leben, nachzudenken und zu erkennen, wie dringlich unsere Zukunftsprojekte sind.
Und dann ist da noch das Dilemma, die Spannung, die in den ersten beiden Fragen Hillels zum Ausdruck kommt. „Wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich?“ Die Juden wissen sehr gut und leider fast zu gut, dass sie die Pflicht haben, sich um ihre Zukunft und ihren Schutz zu kümmern. Denn die Geschichte hat ihnen immer wieder gezeigt, dass die Nationen nicht die Macht, die Fähigkeit oder manchmal auch nicht den Willen haben, ihnen zu helfen.
In so vielen Phasen der Geschichte kam niemand zu Hilfe, trotz Versprechungen, Worten oder manchmal auch den besten Absichten. Die Einsamkeit der Juden war so oft ihre Grundbedingung. Das galt für die Erfahrungen vergangener Generationen, aber es galt auch für unsere Generation und in den letzten Jahren sogar in Frankreich.
Wer konnte trotz der starken Worte der Republik in den letzten Jahren unsere Sicherheit vollständig gewährleisten? Wie viele Menschen sind nach dem Tod von Ilan Halimi 2006 an unserer Seite gelaufen? Wie wenige waren es, die auf die Straße gingen, um ihre Not herauszuschreien? Wie viele Franzosen gingen nach dem Mord an den Kindern von Toulouse im Jahr 2012 auf die Straße? Wer ist im letzten Herbst an unserer Seite gelaufen oder nicht gelaufen?
Verharmloster Antisemitismus
Wie viele verharmlosen heute noch den Antisemitismus, der durch Reden genährt wird, die sich als rein „antizionistisch“ und gar nicht antisemitisch bezeichnen, aber ein Massaker an Juden nicht offen verurteilen oder strategischen, klientelistischen oder „kontextuellen“ Hass tolerieren?
Wenn wir uns nicht umeinander kümmern, wird sich auch niemand um uns kümmern. Die Juden haben leider in so vielen Momenten ihrer Geschichte gelernt, dass sie ihre Kinder beschützen müssen. Und wer könnte diese uralte jüdische Sorge, die jetzt wieder erwacht ist, mit einem Handstreich beiseite schieben?
Doch Hillel fährt mit Angst und Entschlossenheit fort: „Wenn ich nur für mich bin, was bin ich dann?“ Seine Stimme ist die Stimme, die so viele Juden vor uns gehört haben. Diese Stimme sagt: Weil du eine verletzliche Minderheit in der Geschichte warst und bleibst, weil du den Status des Fremden kennst und dich daran erinnerst, dass du selbst dieser Fremde warst, deshalb wirst du dich immer um den anderen kümmern, um die Minderheit, den Verletzlichen, den Fremden, und sein Schicksal wird für immer mit deinem verbunden sein.
Und wenn du vergisst, seine Rechte zu verteidigen, an seine Zukunft zu denken, die Bedrohung, der er ausgesetzt ist, als ein perfektes Echo deiner eigenen zu sehen, was bist du dann? Hüte dich immer vor denjenigen, die dir politisch einen Schutz versprechen, der auf Kosten einer anderen Minderheit, einer anderen Verletzlichkeit gehen würde. Denn unsere Schicksale sind in der Republik miteinander verbunden.
Ein Moment der Entscheidung
Hillels Sprichwort erinnert uns daran, dass die politische Dringlichkeit genau in der Spannung zwischen diesen Sätzen besteht. Sich um uns zu kümmern und gleichzeitig sich um einen anderen zu kümmern, dessen Zukunft unsere Sorge sein muss, weil sie auch unsere eigene bestimmen wird.
Wir stehen vor dem Moment der Entscheidung – der absoluten Dringlichkeit, in der das, was uns leiten soll, gleichzeitig extrem einfach und unglaublich komplex ist. Keine jüdische Stimme darf dem Hass gelten, dem antisemitischen oder rassistischen Hass, dem „antizionistischen“ Hass, der das Recht der Juden auf Selbstbestimmung leugnet, oder dem Hass, der den Fremden bedroht, dessen Herz wir mehr als jeder andere kennen.
Rassismus und Antisemitismus sind der absolute Ruin der Grundfesten unseres Landes. Die Republik beruht genau auf diesen Kämpfen, und es sollte nicht die Aufgabe der Juden sein, daran zu erinnern, sondern die eines jeden, der ein Mindestmaß an Geschichtsbewusstsein besitzt.
Ich weiß nicht, was heute in Frankreich „gut für die Juden“ ist. Aber was ich weiß, ist, dass das, was „schlecht für die Juden“ ist, immer eine Katastrophe für Frankreich selbst ist. Denn unser Schicksal spiegelt immer den Zustand einer Gesellschaft wider – das hat die Geschichte unter so vielen Umständen bewiesen. Unser Schmerz und unsere Angst sind heute auch der Schmerz und die Angst der Republik.
Heute ertönen die Stimmen unserer Großeltern, unserer Familien, die dieses Land liebten und hier Trost und Asyl suchten, die dem Ruf der Aufklärung folgten. Es ist ein ziemlicher Lärm in unseren Köpfen.
Aus dem Französischen von Tania Martini
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







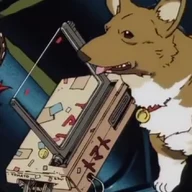
meistkommentiert
Negative Preise durch Solaranlagen
Strom im Mai häufig wertlos
Selenski zu Besuch in Berlin
Militarisiertes Denken
Klima-Urteil des OLG Hamm
RWE ist weltweit mitverantwortlich
Waffenlieferung an Israel
Macht sich Deutschland mitschuldig?
US-Handelspolitik unter Donald Trump
Gericht stoppt Trumps Zollpolitik
Unvereinbarkeitsbeschluss der Union
Überholter Symmetriezwang