Widerspruch gegen Kopftuchverbot: Ein Verbot wäre diskriminierend
Soll der Staat jungen Mädchen das Tragen von Kopftüchern verbieten? Die Bundesregierung reagiert skeptisch auf einen NRW-Vorstoß.
„Ein Verbot löst auch noch nicht das Problem, das dahinter steht“, sagte Widmann-Mauz am Dienstag der Welt. „Wichtig ist doch, dass wir uns fragen, wie wir an diese schwierigen Fälle rankommen: Wir müssen die Eltern erreichen und die Mädchen stark machen, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen.“
Das NRW-Integrationsministerium prüft ein solches Verbot. Vor dem 14. Geburtstag könnten Mädchen nicht selbstbestimmt entscheiden, ob sie das Kopftuch tragen wollen, argumentierte Landesminister Joachim Stamp (FDP). Mit 14 tritt in Deutschland die Religionsmündigkeit ein.
Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, warnte vor Verboten einzelner religiöser Symbole. „Wer das muslimische Kopftuch an Schulen verbieten will, der löst damit keine Integrationsprobleme, sondern trägt dazu bei, dass sich Schülerinnen ausgegrenzt und diskriminiert fühlen“, sagte Lüders am Dienstag in Berlin.
Religionen würden ungleich behandelt werden
Schon jetzt seien muslimische Frauen und Mädchen mit Kopftuch in besonderem Maße von Diskriminierung und Ausgrenzung in Beruf und Alltag betroffen. Wichtiger sei es deshalb, Schülerinnen und Schülern die Bedeutung von Selbstbestimmung zu vermitteln.
Darüber hinaus sei eine solche „Spezialgesetzgebung“ auch verfassungsrechtlich problematisch, da Religionen somit ungleich behandelt würden, mahnte Lüders. „Ein Kopftuchverbot an Schulen würde in letzter Konsequenz auch das Verbot für das Tragen anderer religiöser Symbole wie eines Kruzifix oder einer Kippa zur Folge haben.“
FDP-Chef Christian Lindner verteidigte den Vorstoß des FDP-Ministers aus Düsseldorf. „Wenn Kinder bereits in Grundschulen oder sogar im Kindergarten Kopftuch tragen müssen, greift das in die Persönlichkeitsentwicklung von religionsunmündigen Kindern stark ein“, sagte er Dienstag der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Prüfung, ob und wie der Staat hier eingreifen müsse, sei „ein Baustein einer fordernden Integrationspolitik, die auf dem Boden von Freiheit und Toleranz glasklare Erwartungen formuliert“.
Widmann-Mauz kündigte erneut die Gründung einer Fachkommission an, die Kriterien und Indikatoren für gelingende Integration erarbeiten soll. Dazu gehörten die ausreichende Versorgung mit Kitas, Schulen, Wohnraum und Zugang zum Arbeitsmarkt. „Es geht aber auch um politische Bildung und um die Frage, wie Werte unseres Zusammenlebens – etwa die Gleichstellung – in die Familien hinein vermittelt werden können“, sagte die Integrationsbeauftragte.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






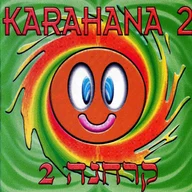





meistkommentiert
+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++
Moskau fordert für Frieden vollständigen Gebietsabtritt
Sozialwissenschaftlerin zur Spargelernte
„Er sagte: ‚Nirgendwo war es so schlimm wie in Deutschland‘“
Kontroverse um Gedenkveranstaltungen
Ein Kranz von Kretschmer, einer von Putin
Mindestlohn
Die SPD eiert herum
Tödlicher Polizeieinsatz in Oldenburg
Drei Schüsse von hinten
Abschiebung nach El Salvador
Und er ignoriert es einfach