Politologe über Russland und den Westen: „Es stehen harte Jahre bevor“
Der russische Experte Andrei Kortunow geht davon aus, dass sich die beiderseitigen Beziehungen noch weiter verschlechtern werden.

taz: Herr Kortunow, die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland waren immer besonderer Natur. Wo haben sich die Partner verloren?
Andrei Kortunow: Die einen sagen, es habe 2014 angefangen, mit der Krise in der Ukraine. Die anderen meinen, der Kaukasuskrieg 2008 sei der ausschlaggebende Punkt gewesen. Wieder andere sehen die Wahlniederlage Gerhard Schröders als Zeitpunkt, an dem die Verschlechterung anfing. Putin und Merkel hatten ja nie ein solches besonderes Vertrauensverhältnis. Mit Frauen an der Macht konnte Putin ohnehin nie viel anfangen. Wann auch immer diese Entwicklung begonnen hat, klar ist: Es findet eine permanente Verschlechterung der Beziehungen statt. Leider.
Woran liegt das?
Zunächst einmal an den politischen Positionen, die sich fundamental unterscheiden. Hinzu kommen auch die wirtschaftlichen Beziehungen. Da dominieren immer mehr andere Partner. Russland wird immer unwichtiger. Zudem findet in der deutschen Politik ein Generationswechsel statt. Frühere Generationen verspürten noch ein Gefühl der Dankbarkeit, ja auch der Schuld gegenüber Russland. Die neue Generation pflegt eine pragmatische Basis für die Pflege der Beziehungen, weniger eine emotionale.
Welche Rolle spielen die Vergiftung und die Verhaftung von Alexei Nawalny?
Nawalny ist ein weiterer Wendepunkt auf diesem langen, immer schlechter werdenden Weg. Er ist ein klares Symbol für die Kluft in den Wertevorstellungen zwischen der Regierung in Deutschland und der Regierung in Russland. Deutschland hat eine bestimmte Haltung zum menschlichen Leben, zur Wichtigkeit politischer Opposition im Land. In Russland – ich spreche hier über die Ebene der Regierung – ist das Verhältnis dazu ein etwas anderes. Putin will sich nicht mit Nawalny befassen. Mit Merkel will Putin solche Fragen schon gar nicht besprechen. Für Merkel aber sind solche Fragen prinzipieller Natur. Sie hat vollkommen andere Prioritäten. Die Kluft, die schon immer da war, sich aber durch die Causa Nawalny viel klarer offenbart, wird weiter zwischen beiden Ländern stehen. Als störendes Element.
Die Ausweisung dreier europäischer Diplomaten aus Russland, zeitgleich zum Besuch vom obersten EU-Diplomaten in Moskau, ist ein Affront. Welches Kalkül steckt hinter dieser Demütigung?
Die Europäer waren unvorbereitet auf den Besuch. Das wollte man ihnen zeigen. Man gab Josep Borrell sehr klar zu verstehen, dass innenpolitische Fragen kein Thema für ein Gespräch mit den Partnern der EU ist. Die Haltung der russischen Gastgeber ist: Wie wir mit unserer Opposition umgehen, ist nicht eure Sache! Lehrerhaftes Auftreten der EU wollte man sich verbitten. Von seinen Position abweichen will der Kreml nicht. Auch hier sehen wir einen Wertekonflikt. Die Europäer werden weiter über Nawalny reden, die Russen nichts von ihm hören wollen.
Ist dem Kreml das Image des bösen Buben völlig egal?
Die russischen Führung hat keine besondere Hoffnung auf eine fruchtbare Entwicklung zwischen Russland und Europa. Erdoğan erlaubt sich mit Moskau um einiges mehr als Europa. Dennoch stellt ihn Putin als Beispiel für einen zuverlässigen Partner dar. Die EU ist in den Augen Putins kein zuverlässiger Partner, weil sie seiner Meinung nach schwach ist. Diskussionen, Pluralismus, Meinungsvielfalt, wie die EU sie pflegt, sind für die Realität, in der die russische Führung lebt, ein Zeichen der Schwäche.
Welche Perspektiven gibt es in dieser verfahrenen Situation?
Das ist ein Dilemma. Doch dabei geht es weniger um Russland und Europa, es geht um die Frage: Wohin bewegt sich die Welt? Putin hat ein recht düsteres Bild von der Welt: Für ihn besteht diese aus Krisen, Konflikten, Kriegen. Priorität haben Sicherheitsfragen. Es geht nicht um Prosperität, es geht ums Überleben. Europa aber geht es um das Miteinander. Um das einzigartige europäische Projekt. Wenn es Europa gelingt, die Anziehungskraft dieser europäischen Idee zu erhalten, muss auch Russland umdenken. Das aber wird noch lange dauern. Moskau wendet sich sicher nicht von Europa ab, aber die Beziehungen dürften sich erst einmal weiter verschlechtern. Moskau und Europa stehen harte Jahre bevor.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








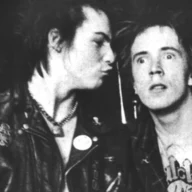
meistkommentiert
Abgrenzung zur AfD
Der Umgang der Union mit der AfD ist Ausdruck von Hilflosigkeit
ACAB bei den Grüüünen
Wenn Markus Söder sein Glück nur in Worte fassen könnte
Queere Bewegungen
Mehr als nur Glitzer
Ausnahme vom EU-Emissionshandel
Koalition plant weiteres Steuergeschenk für Landwirte
Israels Kriegsführung in Gaza
Echte Hungerhilfe geht anders
Sugardating
Intimität als Ware