Linksparteitag in Chemnitz: Überwiegend harmonisch
Auf ihrem Parteitag geht es der Linkspartei vor allem um Selbstvergewisserung. Doch nicht bei allen Themen herrscht untereinander eitel Sonnenschein.

Für zwei Tage hat sich die Linkspartei im früheren Karl-Marx-Stadt versammelt, um ihre Wiederauferstehung zu feiern. Der Parteitagstermin war schon im vergangenen Jahr festgelegt worden, als die Linke noch glaubte, sich einer Bundestagswahl im September entgegenzittern zu müssen. Nun ist alles anders gekommen: Die Partei hat bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar mit 8,8 Prozent ein spektakuläres Comeback geschafft. Und statt der ursprünglich geplanten Bundestagswahlprogrammdiskussion steht jetzt Selbstvergewisserung auf der Tagesordnung.
„Die Hoffnung organisieren“, lautet das Parteitagsmotto. „Wir sind zurück, und die sollen sich warm anziehen“, sagt die Co-Parteivorsitzende Ines Schwerdtner in Richtung der schwarz-roten Koalition von Friedrich Merz. Die Linke verstehe sich als „die soziale Opposition“ im Bundestag. „Wir haben in diesem Wahlkampf wirklich unendlich viel gewonnen: an Vertrauen, an Glaubwürdigkeit und an Schlagkraft“, so Schwerdtner, die nach Reichinnek spricht.
Jetzt stehe ihre Partei vor einer großen Aufgabe. „Unser Weg zu einer organisierenden Klassenpartei hat gerade erst begonnen“, sagt Schwerdtner. Dazu zähle, die Linke zu einer Partei weiterzuentwickeln, „die wie eine Art Universität für alle ist“. Sie solle eine Partei werden, in der „erfahrene Genoss:innen den Schatz ihres Wissens weitergeben können“ und „viele junge Menschen, die zu uns gekommen sind, eine Perspektive auf eine andere, eine solidarische Gesellschaft entwickeln“.
Seit dem Abgang von Sahra Wagenknecht und ihrem Anhang befindet sich die Linkspartei in einem Transformationsprozess. Noch Ende 2023 mit rund 50.000 Mitgliedern auf einem historischen Tiefstand, zählt sie inzwischen mehr als 112.000 Mitglieder. Sie ist jünger und weiblicher geworden. Zwar legte sie in allen Landesverbänden zu, besonders jedoch im Westen. So verfügt die Linke laut einer für den Parteitag erstellten Erhebung nun über etwa 69.000 Mitglieder in West- und gut 43.000 in Ostdeutschland. Aber wie fragil ist der gegenwärtige Aufschwung? Das ist die große Frage, die viele Delegierte wie auch Parteiführung umtreibt.
Schwerdtner plädiert für eine „neue Parteikultur“
Eine Lehre aus der vergangenen langen Krisenzeit ist, den klassischen linken Hang zur Selbstzerfleischung zu überwinden. Wenn sie von „revolutionärer Freundlichkeit“ spreche, meine sie das ernst, sagt Schwerdtner. Ihr sei es „wichtig, dass wir eine neue Parteikultur entwickeln“. Es gehe „nicht darum, keine Fehler zu machen oder nicht mehr zu streiten, es geht darum, eine Kultur zu entwickeln, die uns nicht mehr zerreißt“. Denn nur eine Partei, die untereinander solidarisch ist, könne glaubhaft vermitteln, für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen.
In der Praxis ist das nicht ganz so einfach. Zwar gibt es in Chemnitz keine hitzköpfigen oder gar verletzenden Diskussionsschlachten, wie so häufig auf früheren Parteitagen. Aber das hat seinen Preis. Denn erfolgreich hat sich die Parteiführung bereits im Vorfeld darum bemüht, unterschiedliche, auch sich widersprechende Vorstellungen mittels etlicher Kompromissformulierungen und einiger Wortakrobatik unter einen Hut zu bringen.
Beim mit großer Mehrheit beschlossenen Leitantrag funktioniert das ganz gut: Von 211 Änderungsanträgen bleiben mit einigem diplomatischen Geschick nur ein paar wenige übrig. Aber hier gab es auch keinen grundsätzlichen Streit. Von denen bekommt nur ein einziger Änderungsantrag eine Mehrheit: Rausgestrichen aus dem Leitantrag wird nur die ambitionierte Zielstellung, innerhalb von vier Jahren auf 150.000 Mitglieder anwachsen zu wollen.
Das Problem, möglichst alles unter einen Hut bringen zu wollen, zeigt sich jedoch am Freitagabend, als auf der Tagesordnung ein Thema steht, das ursprünglich identitätsstiftend für die Linke war: die Friedenspolitik. Was bedeutet es angesichts einer komplizierter gewordenen Weltlage heute noch, sich als „Friedenspartei“ zu verstehen? Darüber gehen die Auffassungen weit auseinander. Trotzdem ist es dem Parteivorstand gelungen, aus vier divergierenden Anträgen einen einzigen mit dem Titel „Ohne Wenn und Aber: Sage Nein zu Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit!“ zu machen.
„Gerade jetzt braucht es eine klare und eindeutige Haltung“, heißt es darin. Doch genau daran fehlt es, weil es keine gemeinsame Einschätzung gibt, ob und welche Gefahr vom russischen Imperialismus ausgeht. Also wird sich darum herumgedrückt. Stattdessen heißt es nur: „Mit der Behauptung, Russland könne bald Nato-Territorium angreifen, werden bewusst Ängste geschürt.“
Es wird nicht einmal benannt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Auch die Forderung nach einem russischen Rückzug fehlt, stattdessen wird nur beklagt, dass die EU keinerlei diplomatische Initiativen ergriffen habe, „um den Krieg zu beenden und wieder zu einer eigenständigen Entspannungspolitik in Europa zu gelangen“.
„Also bitte Leute, kommt doch mal auf den Boden der Tatsachen“
Kritiklos passiert der Antrag den Parteitag nicht. Von „Realitätsverweigerung“ spricht die Wiesbadener Stadträtin Brigitte Forßbohm in der halbstündigen Diskussion über den Antrag. Sie finde „es schon ein ziemliches Kunststück, es fertigzubringen, sich für Frieden auszusprechen, und dabei den schlimmsten Krieg, der in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg in der Ukraine stattfindet, so zu verharmlosen“. Russland setze auf einen militärischen Sieg über die Ukraine und demonstriere Desinteresse an diplomatischen Lösungen. „Also bitte Leute, kommt doch mal auf den Boden der Tatsachen“, fordert sie.
Er wisse, dass in dem Antrag „Sätze drinstehen, die nicht von dem ganzen Parteitag geteilt werden“, räumt Parteivorstandsmitglied Wulf Gallert ein. Doch bei aller Kritik werbe er für die Annahme, weil es wichtig sei, „eine ganz klare Alternative zur militaristischen Debatte in der Bundesrepublik“ zu formulieren. Mit einer breiten Mehrheit folgen ihm die Delegierten, auch des lieben innerparteilichen Friedens Willen. Beendet ist die Diskussion damit jedoch nicht.
Am Samstagnachmittag wird es noch mal spannend. Die linksjugend.solid und der Studierendenverband Die Linke.SDS fordern den Rücktritt der linken Minister:innen und Senator:innen in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, die im Bundesrat für das milliardenschwere Finanzpaket von Schwarz-Rot gestimmt haben. „Wer so abstimmt, zerstört die Geschlossenheit der Partei“, kritisiert ein Antragssteller. Parteichefin Ines Schwerdtner zeigt Verständnis für den Unmut, bittet aber darum, an Einzelnen kein Exempel zu statuieren. „Wir haben ein verbindliches Verfahren beschlossen, dass es nie wieder passieren kann, dass Landesregierungen anders abstimmen als wir im Bundestag“, sagt sie. Der Antrag wird nur knapp abgelehnt, mit 219 zu 192 Stimmen.
Heftige Diskussionen über Anträge zum Gaza-Krieg
Heftige Diskussionen hatte es hinter den Kulissen über mehrere Anträge zum Gaza-Krieg gegeben. Auch hier gelingt der Parteiführung, die internen Differenzen mit der Verständigung auf einen gemeinsamen Antrag zu überbrücken. Er trägt den Titel „Vertreibung und Hungersnot in Gaza stoppen“ und fordert, die militärische Unterstützung Israels sofort zu beenden. Parteichef Jan van Aken verkündet selbst am Mikrofon die Verständigung und wirbt um Zustimmung. Die jüngsten Beschlüsse des israelischen Sicherheitskabinetts liefen auf eine Vertreibung der Bevölkerung hinaus. Mit sehr großer Mehrheit wird der Antrag angenommen.
Ein weiterer Antrag fordert, sich die Antisemitismus-Definition der „Jerusalemer Erklärung“ zu eigen zu machen, die 2020 von Wissenschaftler*innen und Antisemitismusexpert*innen erstellt wurde. Diesmal plädiert van Aken dafür, den Antrag abzulehnen. „Das ist eine wissenschaftliche Debatte“, die Partei solle ihr nicht vorgreifen. Doch das Argument verfängt nicht.
„Das ist keine akademische Frage, sondern eine konkrete Frage für viele, die davon betroffen sind“, kontert die Europa-Abgeordnete Özlem Alev Demirel. Denn mit dem Antisemitismus-Vorwurf würden Kritiker:innen der israelischen Regierung mundtot gemacht. Mit 213 zu 181 wird der Antrag angenommen. Eine Niederlage für die Parteispitze, die es aber mit Fassung trägt.
Bundesgeschäftsführer Jannis Ehling beendet den Tag versöhnlich und bedankt sich für die gute Atmosphäre auf dem Parteitag. Am Ende seiner Rede erklingt die „Internationale“. Alle Delegierten stehen auf und stimmen die alte Hymne der Arbeiterbewegung an. Etliche recken die Faust. Als die Musik nach der ersten Strophe endet, singen immer noch viele weiter bis zur dritten Strophe und der Sonne, die ohne Unterlass scheint. Es ist ein wenig wie nach einem Film, wenn der Abspann läuft. Damit ist der Parteitag beendet.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








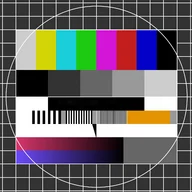



meistkommentiert
Urteil zu Asylpolitik
Zurückweisungen sind rechtswidrig
Urteil zu Zurückweisungen an den Grenzen
Dobrindt hätte die Wahl
Kontroverser Pulli von Jette Nietzard
Hausverbot für Klöckner!
Sugardating
Intimität als Ware
Palästina-Solidarität
Greta Thunberg bringt Hilfsgüter per Segelschiff nach Gaza
Verkehrswende in Berlin-Lichtenberg
Keine Ruhe