Kommentar Rechter Terror in den USA: Mut zur Gewalt, dank Donald Trump
Donald Trump hat Neonazis im Wahlkampf gezielt umworben. Ihr neues Selbstbewusstsein führte zu dem Terrorismus von Charlottesville.
I n Charlottesville ist ein Mann, der seine Facebook-Seite mit Hakenkreuzen und einem Hitler-Foto bestückt hat, mit dem Auto in eine Menge von linken Demonstranten gerast und hat dabei eine Frau getötet und 19 weitere Menschen verletzt. Das ist Terrorismus. Es ist hausgemachter Terrorismus, den keine Grenzmauer, kein Einreiseverbot für Muslime und keine noch so massive Aufrüstung und Aufstockung der Grenz- und Abschiebebehörden hätte verhindern können.
Als wenn das nicht bedrohlich genug wäre, kommt hinzu, dass die Gewalttat im Rahmen eines Aufmarsches von Tausenden von Gleichgesinnten geschah. Genau wie der mörderische Autofahrer sind sie alle nach Charlottesville gekommen, um eines ihrer Symbole zu verteidigen: ein Reiterdenkmal für den General der Konföderiertenarmee, Robert E. Lee, zu verteidigen, der im Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei gekämpft hat.
Die Neonazis und andere Rechtsradikale brachten nicht nur ihre Hakenkreuze und Konföderiertenfahnen und ihren Hass auf Afroamerikaner, auf Muslime, auf Juden und auf Schwule – um nur einige Beispiele zu nennen – mit, sondern sie trugen auch schwere Waffen durch die Stadt. Ihre Demonstration enthielt die Drohung an alle anderen, dass sie zum Äußersten entschlossen sind.
Militärisch trainierte Milizen, offen rassistische Gruppen und Neonazis sind kein neues Phänomen in den USA. Sie operieren seit Jahrzehnten, haben Netzwerke quer durch das Land aufgebaut und konnten – dank der geschützten Meinungsfreiheit – Neonazis aus dem Rest der Welt anlocken. Doch bislang traten sie vor allem in den Sozialen Netzen, bei Konferenzen und bei (vermummten) nächtlichen Versammlungen auf. Jetzt kommen sie massiv, unvermummt und bei Tag auf die Straße. Charlottesville war ihr größter Auftritt seit Jahrzehnten.
Sie haben wegen eines Mannes inzwischen neuen Mut geschöpft: Donald Trump. Der hat die Rechtsradikalen in seinem Wahlkampf umworben. Hat ihre Themen aufgegriffen und zu seinen Slogans gemacht. Und hat sich von ihren Führern unterstützten lassen. Von Charlottesville aus haben sie ihm zurückgerufen, dass sie ihn beim Wort nehmen und „ihr“ Amerika zurück erobern wollen.
Wenn der US-Präsident diese Unterstützung nicht haben wollte, müsste er Neonazis und andere Rechtsradikale eindeutig verurteilen. Stattdessen hat er in seiner Reaktion auf den terroristischen Akt von Charlottesville die Verantwortung auf „viele Seiten“ verteilt und sich hinter einer Wischi-Waschi-Erklärung an Amerikaner „jeder Hautfarbe, jeden Glaubens und politischen Partei“ versteckt. Für die Neonazis und anderen Rechtsradikalen, die von Charlottesville ein Land in Schrecken versetzen, bedeutet das noch mehr Rückenwind.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen











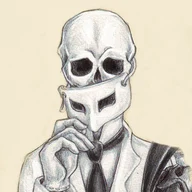
meistkommentiert