Defizitverfahren gegen Spanien: Ein Ende mit Schrecken
Die EU stellt nach zehn Jahren das Defizitverfahren gegen Spanien ein. Der soziale Kahlschlag war für die Bevölkerung verheerend.
Vorschullehrerinnen in Madrid streiken gegen Hungerlöhne. Taxifahrer machen gegen die unlautere Konkurrenz von Uber und anderen mobil. Gerichtsvollzieher räumen säumige Wohnungseigentümer und Mieter: So sieht der Alltag in Spanien zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise aus.
Während die Wirtschaftspresse, die Großunternehmen und die Banken von Erholung sprechen, gärt es unten. Am Freitag wird der Rat der Wirtschaftsminister der Europäischen Union auf Anraten der EU-Kommission wahrscheinlich das Ende des Defizitverfahrens beschließen. Damit ist das letzte dieser Verfahren aus der Finanzkrise beendet, es lief gegen 24 der 27 EU-Staaten wegen zu hoher Neuverschuldung. Spanien hält wieder die meisten Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts der EU ein. Das Haushaltsdefizit lag 2018 mit 2,5 Prozent deutlich unter der 3-Prozent-Vorgabe aus Brüssel.
Grund zum Feiern? Nicht für die Gewerkschaften und Organisationen aus dem Sozialbereich. 120 von ihnen sind im „Staatlichen Sozialgipfel“ zusammengeschlossen, sie sprechen von „einem verlorenen Jahrzehnt“. Die Statistiken sprechen für sich. Die Armut stieg seit 2008 von 23,8 Prozent der Haushalte auf 26,6 Prozent. 28,3 Prozent der Kinder leben in Armut oder sind unmittelbar davon gefährdet. Im EU-Schnitt sind es nur 20,2 Prozent. Damit ist Spanien die Nummer drei bei der Kinderarmut in Europa. Umfragen zum Konsumverhalten zeigen, wie schlecht es vielen Haushalten geht. 2018 gaben 38,1 Prozent der Spanier an, dass sie keine Rücklagen für unerwartet Ausgaben hätten. 34,4 Prozent fehlt das Geld, um für eine Woche im Jahr zu verreisen. 2016 waren es 29,5 Prozent.
7,4 Prozent der Haushalte waren im Laufe des Jahres 2018 nicht in der Lage, die Kreditraten, Mieten, Gas oder Strom rechtzeitig zu bezahlen. Die Spanier haben in den zehn Jahren der Sparpolitik 7,1 Prozent ihrer Kaufkraft verloren. War vor der Krise das Wort „Mileurista“ – derjenige, der 1.000 Euro im Monat verdient – der Begriff für prekäre Arbeitsverhältnisse schlechthin, sind heute 1.000 Euro ein guter Lohn. Jeder dritte Spanier kann von seinem Lohn nicht leben. Die Rentenanpassung wurde mehrere Jahre ausgesetzt. Schlimmer noch, die Rentenkasse ist nach den Krisenjahren leer. Die soziale Schere geht immer weiter auf. 2006 verfügten 10 Prozent der reichsten Spanier über 10-mal so viel wie die ärmsten 10 Prozent. 2017 waren es 15-mal so viel.
Laut einer Studie der Caritas-Stiftung Foessa sind heute 8,5 Millionen Menschen, 18,4 Prozent der Bevölkerung, von sozialer Ausgrenzung betroffen. Dies sind 1,2 Millionen mehr als 2007. Selbst diejenigen, die „die Chancen des Beschäftigungswachstums genutzt haben (…) bleiben ohne Absicherung im Falle eines neuen Rückschlags“, erklärt Foessa-Präsident Manuel Bretón. „Die nächste Rezession wird sie mit wesentlich weniger Widerstandskraft treffen.“
Daran sind nicht zuletzt zwei Reformen des Arbeitsmarkts schuld. Die eine hat der ehemalige sozialistische Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero verabschiedet, die andere dessen konservativer Nachfolger Mariano Rajoy. Entlassungen sind leichter und vor allem billiger geworden. Knapp 30 Prozent aller spanischen Arbeitnehmer haben nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Davon hat mehr als die Hälfte eine Laufzeit von höchstens sechs Monaten.
Spanien weist damit die höchste Quote an befristeten Verträgen in der EU auf. 13,9 Prozent sind noch immer ohne Arbeit. Bei den unter 25-Jährigen sind es gar 33,5 Prozent. Der sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez will die Arbeitsmarktreformen erst einmal nicht rückgängig machen. Das versprach er allerdings im Wahlkampf. Im Juni 2017 kam er zunächst nach einem Misstrauensvotum ins Amt und gewann im vergangenen April die Wahlen.
„Wir brauchen dringend einen Staatshaushalt mit mehr Ausgaben“, fordert der Generalsekretär der Gewerkschaft UGT, Gonzalo Pino. Die Sozialleistungen wurden ausgerechnet in den Jahren am stärksten gekürzt, in denen sie am nötigsten gewesen wären. 2011 gab der Staat noch für 156,8 Arbeitslose 1 Million Euro, 2015 mussten damit bereits 233 Arbeitslose auskommen. Seit 2009 wurden im Gesundheitswesen, je nach Schätzung, zwischen 15 und 21 Milliarden Euro eingespart. Heute fließen jährlich 12 Prozent weniger in die Bildung als vor der Krise.
Doch auch wenn die Defizitkontrolle jetzt aufgehoben wird, bedeutet dies nicht das Ende der Sparpolitik. Denn laut EU leitet Spanien weiterhin unter einem strukturellen Defizit. Dabei handelt es sich um den Teil des Staatsdefizits, der nicht auf konjunkturelle Schwankungen zurückzuführen ist. Und dies müsse bekämpft werden. Allein im kommenden Haushalt sollen, so die Empfehlung Brüssels, weitere 7,8 bis 8,2 Milliarden Euro eingespart werden. Statt zu sparen, könnte Spanien freilich auch seine Staatseinnahmen verbessern. Bei den Steuern wäre viel Spielraum, wenn das politisch gewollt wäre.
Denn die Steuerlast liegt in Spanien 7 Prozent unter dem Schnitt der Eurozone. Außerdem ging die abgesetzte konservative Regierung all die Krisenjahre mit dem Geld großzügig um, zumindest, wenn es um Rettung des Finanzsektors ging. Spanien gab 60 Milliarden Euro für die Bankenrettung aus. Laut der Spanischen Zentralbank wurden 42 Milliarden nie zurückbezahlt. Weitere 5 Milliarden Euro flossen an die Betreiber von Maut-Autobahnen; die Straßen waren nie wirklich rentabel.
Die Diskussion bestimmen allerdings andere Maßnahmen. Die Unabhängige Behörde für die spanische Steuerverantwortung (Airef) schlägt vor, die Post weitgehend zu schließen. Bevor diese Idee für Schlagzeilen sorgte, wusste kaum ein Spanier zu sagen, was die Airef ist. Die Behörde entstand 2013 auf Druck Brüssels. Sie wacht über die Ausgaben und über die Schuldenbremse, die 2011 in die Verfassung geschrieben wurde, und Schuldenzahlungen Vorrang vor Sozialausgaben gibt.
„Ich glaube, dass Spanien das Defizit nicht über weitere Austerität, sondern mittels einer besseren Steuerpolitik senken muss“, mahnt der Generalsekretär der größten spanischen Gewerkschaft CCOO, Unai Sordo. Er hofft darauf, dass die Sozialisten von Sánchez zusammen mit der linksalternativen Unidas Podemos eine „stabile Regierung des Fortschritts“ bilden werden, die dann entsprechende Reformen umsetzt.
Portugal ging einen ganz anderen Weg als Spanien. Der dortige sozialistische Regierungschef António Costa, der seit 2015 dank der Unterstützung mehrere kleinerer linker Parteien im Amt ist, verabschiedete sich von der Sparpolitik. Stattdessen hob er die Renten wieder an, erhöhte den Mindestlohn, führte gestrichene Feiertage wieder ein, verkürzte die Wochenarbeitszeit im öffentlichen Dienst, nahm Lohn- und Gehaltskürzungen zurück. Privatisierungen wurden gestoppt, die Steuern für Besserverdienende angehoben. Anders als von Brüssel prophezeit hatte er damit Erfolg.
Portugals Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit geht schneller zurück als in Spanien. Lissabon hält schon länger die Defizitvorgaben ein als Madrid und zahlt Schulden beim Internationalen Währungsfonds schneller ab als vorgesehen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







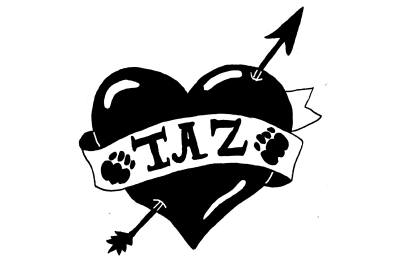
meistkommentiert
Wissenschaftliche Debatte um Migration
Menschenrechte, aber nicht für alle
Frauenwaggons im ÖPNV
Ein guter Ansatz
+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++
Moskau fordert für Frieden vollständigen Gebietsabtritt
Wirtschaftskrise in Deutschland
Habeck ist nicht schuld
Todesschüsse auf Lorenz A. in Oldenburg
Das Rätsel um das Messer
Angriff auf die taz
Gezielt getroffen