US-Außenpolitik: Transatlantische Scheidung
Nach wenigen Wochen Trump-Regierung ist das westliche Bündnis mit den USA nach einem Dreivierteljahrhundert am Ende. Die Folgen sind kaum absehbar.

Was in den vergangenen Tagen deutlich wurde, zunächst auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende und dann in den Äußerungen Donald Trumps aus Washington, geht weit über jenes Beklagen ungleicher Lastenverteilung innerhalb der Nato hinaus, das seit Barack Obamas Regierungszeit aus den USA zu vernehmen war.
Auch Obama hatte gefordert, die europäischen Staaten müssten sich mehr um ihre eigene Sicherheit kümmern. Auch er hatte in Aussicht gestellt, die USA würden sich strategisch weg von Europa zum asiatischen Raum hin ausrichten. Der Nato-Beschluss von 2014 beim Gipfel in Wales – alle Länder sollten anstreben, mindestens 2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben – war ein Ergebnis dieser Haltung.
In keinem Moment allerdings stellte Obama infrage, dass die USA ihren Verpflichtungen insbesondere aus Artikel 5 des Nato-Vertrages, also dem gegenseitigen Beistand im Falle eines Angriffs auf ein Mitgliedsland, nachkommen würden.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Streit gab es immer – aber keinen grundsätzlichen Bruch
Differenzen zwischen Europa und den USA gab es während all der Jahrzehnte. Als in den 1990er Jahren die Verhandlungen über das Rom-Statut zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs in die Endphase gingen, rangen europäische und US-amerikanische Verhandler – damals noch unter Präsident Bill Clinton – um jede Zeile. Nur um dann zu erleben, dass die USA den Vertrag nicht ratifizierten und Clintons Nachfolger, George W. Bush, die US-Unterschrift wieder zurückzog.
Deutschland und Frankreich stritten sich heftig mit der Regierung von Bush, als die USA mit der erlogenen Begründung, das Regime von Saddam Hussein bedrohe die Welt mit Massenvernichtungswaffen, in den Irak einmarschierten. Obamas Verhandlungsdelegationen auf dem Weg zum internationalen Klimaabkommen von Paris, das 2016 in Kraft trat, waren ständige Gegenspieler der Europäer, auch bevor Obamas Nachfolger Donald Trump 2017 dann den Austritt der USA aus dem Abkommen erklärte.
Doch das waren Meinungsverschiedenheiten zwischen Verbündeten, die mehr verband als eine Unterschrift unter irgendwelchen Verträgen. Die USA hatten als größte westliche Siegermacht des Zweiten Weltkriegs ihre Vorstellung rechtsstaatlicher liberaler Demokratien zum Kernstück des westlichen Selbstverständnisses gemacht. Das galt selbst dann für die Kernländer des Atlantischen Bündnisses, wenn in der Peripherie im Namen der Kommunismusbekämpfung Menschenrechte und Demokratie mit Füßen getreten wurden.
Überparteilicher Konsens bei Bündnistreue
In all diesen Zeiten herrschte zwar auch in den USA mitunter Parteiendissens über Detailfragen der Außenpolitik, was in den letzten zwei Jahrzehnten auch immer wieder die Rolle der Vereinten Nationen betraf. Aber in Fragen der Bündnistreue und der Identifikation von Freund und Gegner gab es einen weitgehenden überparteilichen Konsens.
Mit dem Aufstieg der radikalen Rechten, sichtbar spätestens seit dem Aufkommen der Tea Party zu Beginn der Amtszeit Obamas, begann zunächst der gesellschaftliche Konsens innerhalb der USA zu zerfallen. In der Folge zerbrach dann auch der außenpolitische.
Donald Trump, J. D. Vance und Elon Musk stehen für ein Modell der regellosen Interessendurchsetzung. Die USA bauen sie zu einem autoritären Führerstaat um, der Gewaltenteilung nur noch aus den Geschichtsbüchern kennt. Ideologisch ist ihr Handeln eingebettet in antifeministische Männlichkeitsideale aus dem frühen 20. Jahrhundert, gepaart mit der Idee der Aufteilung der Welt in Einflusszonen der Großmächte. Kein Wunder, dass Wladimir Putin verkünden ließ, er stimme mit den Ausführungen Trumps zu 100 Prozent überein.
Erstes Opfer dieser neuen Allianz könnte die Ukraine werden. Viel schneller als vermutet sehen sich die Europäer jetzt gefordert, ihre eigenen Demokratien gleich gegen zwei feindliche Großmächte zu verteidigen – eine Situation, deren Konsequenzen noch nicht einmal im Ansatz verstanden sind.
Eine Koalition, die was bewegt: taz.de und ihre Leser:innen
Unsere Community ermöglicht den freien Zugang für alle. Dies unterscheidet uns von anderen Nachrichtenseiten. Wir begreifen Journalismus nicht nur als Produkt, sondern auch als öffentliches Gut. Unsere Artikel sollen möglichst vielen Menschen zugutekommen. Mit unserer Berichterstattung versuchen wir das zu tun, was wir können: guten, engagierten Journalismus. Alle Schwerpunkte, Berichte und Hintergründe stellen wir dabei frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade jetzt müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Was uns noch unterscheidet: Unsere Leser:innen. Sie müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Es wäre ein schönes Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






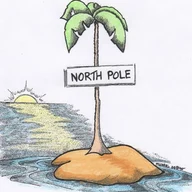

meistkommentiert
Forscher über Einwanderungspolitik
„Migration gilt als Verliererthema“
Abschied von der Realität
Im politischen Schnellkochtopf
Erstwähler:innen und Klimakrise
Worauf es für die Jugend bei der Bundestagswahl ankommt
Sauerland als Wahlwerbung
Seine Heimat
Pragmatismus in der Krise
Fatalismus ist keine Option
Leak zu Zwei-Klassen-Struktur beim BSW
Sahras Knechte