Taxibranche unter Druck: Freiheit war gestern
Sie führen einen erbitterten Kampf und geben nicht auf. Wie sich Berliner Taxifahrerinnen und Taxifahrer gegen den Untergang stemmen.
V or Mustafa’s Gemüse Kebap stehen die Touris Schlange. Freitagabend, Kreuzberg, Halteplatz am Mehringdamm. Uwe Jessen, 57, steigt aus seinem Taxi und dreht sich erst mal eine Zigarette. Lässig lehnt er an der Beifahrertür und pustet den Rauch in die schwüle Sommerluft. Seit einer halben Stunde wartet er schon.
Jessen holt eine Tube Chin Min-Salbe aus dem Handschuhfach und reibt sich Schultern und Nacken ein. Gegen die Schmerzen vom vielen Sitzen.
Ein paar Meter weiter vorne, Ecke Yorckstraße, hält ein weißer Toyota Prius. In der Heckscheibe rechts unten die blaue Ordnungsnummer, wahrscheinlich ein Auto von Uber. Eine Gruppe junger Leute steigt ein. Sie sind zu siebt.
Uwe Jessen dreht sich noch eine. Schon seit 29 Jahren fährt er Taxi. Ohne Geduld geht’s nicht, redet er sich das Warten schön. Das Spontangeschäft sei halt schwierig geworden, sagt er.
Dann sprechen ihn endlich zwei Pärchen an, die zum Café am Neuen See wollen. Sie steigen ein.
4,7 Kilometer, 4 Leute, 17,30 Euro, kein Trinkgeld.
Als er sie abgesetzt hat, kommt Uwe Jessen zurück zum Halteplatz am Mehringdamm. Fünf Taxis stehen schon dort, aber er hat keine Lust, sich wieder hinten einzureihen. Bloß nicht noch mal warten. Also fährt er weiter ins Nova, eine Kreuzberger Kiezkneipe, die genauso in die Jahre gekommen ist wie West-Berlin und die Taxibranche. Mit einem Pils und einer Kippe lässt er sich auf einen Stuhl plumpsen.
Uwe Jessen lebt den alten Taxitraum: Durch die Stadt fahren, am liebsten nachts, immer dahin, wo was los ist. Für ihn, sagt er, zählt Freiheit. Jederzeit sagen zu können: Ich habe jetzt keinen Bock mehr und gehe in ’ne Kneipe.
Wobei Freiheit immer häufiger heißt: rumstehen und zusehen, wie ihm Fahrdienste wie Uber, Bolt und Free Now mit ihren Fixpreisen die Fahrgäste wegschnappen.
Und jetzt?
***
In Hermsdorf, am Rand von Berlin, schaltet Gundi*, 64, in den Rückwärtsgang. Der Mercedes Kombi, Pastellgelb, oder in Taxisprache: Hellelfenbein, ist schon ihr zehntes Taxi. Aus den Lautsprechern tönt „Und es war Sommer“ von Peter Maffay.
Gundi wendet, gibt Gas und fährt los, entlang gepflegter Vorgärten. Vor dem Haus von Frau Haag hält sie an. Eine Pflegekraft bringt die alte Dame zum Auto, Gundi hilft ihr, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Dreimal die Woche fährt sie Frau Haag zur Krankengymnastik nach Tempelhof und wartet vor dem Rehazentrum, eine Stunde lang. Während sie wartet, liest sie. Gerade klemmt in der Ablage ihrer Fahrertür Martin Suters neuester Roman „Melody“.
Gundi hat auch ein Schwarz-Weiß-Foto dabei. Sie liebt dieses Foto, weil es sie an jene Zeit erinnert, in der Taxifahren noch Glamour hatte. Als sie, statt Omas, Stars und Manager durchs alte West-Berlin chauffierte, als ihr Taxi nach Parfumwolken, Alkohol und dem Schweiß durchtanzter Nächte roch. Auf dem Foto fläzt sich Gundi lässig auf den Fahrersitz ihres ersten Taxis und schaut nach oben durch das Panoramadach.
Vor allem bei ihren männlichen Kollegen sorgte ihre Pose damals für Diskussionen, erzählt Gundi. So habe einer gesagt: „Auch noch in dieser Position? Noch unanständiger geht ja nicht.“ Ein anderer habe sie aufgefordert, nach Hause zu gehen, an den Herd, wo sie hingehöre.
Gundi war das egal. Gleich mit 18 hat sie den Führerschein gemacht, mit 20 den Taxischein. Eher ging es nicht, denn man muss zwei Jahre Fahrpraxis nachweisen, um anfangen zu dürfen. Seit sie sechs war, träumte sie schon vom Taxifahren.
Und dann ging es endlich los, ihr wildes Taxileben. Überraschend und frei und auch ein bisschen gefährlich.
Verdammt lange her.
Kurz vor 15 Uhr geht Gundi zur Eingangstür des Rehazentrums, wirft sich Frau Haags Handtasche über die Schulter und stützt sie auf dem Weg zum Auto. Gundi könnte auch den faltbaren Rollstuhl aus dem Kofferraum holen, den sie extra für Fahrgäste wie Frau Haag angeschafft hat. Doch Frau Haag ist stolz, dass sie die paar Meter bis zum Auto nur mit Hilfe von Gundi und einem Gehstock schafft.
Ihr Taxileben hat sich im Laufe der Jahre ganz schön verändert, wird Gundi später sagen. Erst erlitt ihr Vater mehrere Schlaganfälle, dann wurde ihre Schwester schwer krank. Und so, wie ihre eigene Familie alterte, alterte auch die Kundschaft im Taxi. Irgendwann fuhr Gundi die Leute nicht mehr zu Clubs oder Partys, sondern zu Dialysezentren oder Onkologen.
Fahrdienste wie Uber, Bolt oder Free Now sind Vermittlungsplattformen. Sie funktionieren über eine App, über die man als Kund*in registriert ist. Bestellt man eine Fahrt zum gewünschten Zielort, bekommt man sofort den Preis angezeigt, der meistens deutlich unter dem eines Taxis liegt. Die App zeigt auch an, welche Autos in der Nähe sind.
Anders als Taxis sind Fahrdienste nicht Teil des öffentlichen Personennahverkehrs, die Autos haben keine ausgewiesenen Standorte und auch keine eigenen Fahrspuren. Juristisch handelt es sich um Mietwagen, die eigenen Unternehmen gehören und die man samt Fahrer*innen bucht. Nach der Fahrt müssen sie eigentlich zu ihren Standorten zurückkehren und dürfen nicht wie Taxis durch die Stadt cruisen.
Um Chancengleichheit herzustellen, gibt es in München seit September 2023 eine Festpreisregelung für Taxi-Fahrgäste. Bestellen diese das Taxi vor der Fahrt per App, fahren sie zu einem festgelegten Preis, also genau wie bei Uber & Co. Winken Fahrgäste ein Taxi vom Straßenrand heran, läuft wie gewohnt das Taxameter mit und der Preis wird während der Fahrt berechnet. Andere Städte wie Berlin und Frankfurt am Main wollen diesem Beispiel folgen.
Ohne es zu ahnen, war sie in der Zukunft der Taxibranche angekommen.
***
Leszek Nadolski, 58, sagt nicht, dass früher alles besser war. Er sagt, die Mobilität habe sich verändert. Er sagt, die Guten, die würden nicht jammern. Nur die Schlechten, die würden jammern. Er sagt, es gehe immer irgendeine Tür auf, man müsse sie nur bemerken. Wenn er über die Schlechten, also über Uber und Co., lästert, entwischt ihm höchstens mal ein „Möchtegerntaxifahrer“. Die Krise der Taxibranche? „Eine Frage der Perspektive“.
Leszek Nadolski, ein kleiner Mann mit langsamem Gang und gütigem Lächeln, ist Chef der Berliner Taxi-Innung. Als Metallarbeiter kam er Mitte der Achtziger nach Deutschland. Um sich den Meisterbrief zu finanzieren, fing er in den Neunzigern an, Taxi zu fahren. Seiner Frau erzählte er damals, das sei nur vorübergehend, maximal drei Monate. Mittlerweile sind es mehr als 30 Jahre.
Die Haare an seinem Hinterkopf stehen die meiste Zeit ab, so als hätte er sich im Schlaf unruhig hin- und hergewälzt. Und tatsächlich schläft er oft schlecht, sagt er. Meistens geht er um 23 Uhr ins Bett und steht um 4 Uhr morgens wieder auf. Kurz darauf steigt er in sein Taxi.
Gerade aber sitzt er in der Ebersstraße in Schöneberg an einem dunklen Holztisch, im Büro der Taxi-Innung. Die Sitzflächen der Lederstühle sind schrumpelig von den vielen Hintern, die hier schon gesessen haben müssen, an den Wänden stehen Schränke in Dunkelbraun. Ein Raum wie aus der Zeit gefallen – wäre da nicht der riesige Flachbildschirm auf dem Sideboard.
Nadolski hat seinen Laptop daran angeschlossen. Die Lesebrille auf der Nasenspitze, füllt er für einen Kollegen den Antrag zur Förderung für ein Elektroauto aus. Ein Tesla-Taxi soll es sein.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Nadolski sagt, er sei nicht nur Chef, sondern alles, was er eben sein müsse. Fahrer, Freund, Vorsitzender. Und wenn es sein muss, auch derjenige, der versucht, die Taxibranche zu retten.
Im Eingangsbereich der Taxi-Innung liegt ein Haufen Papierkram. Links auf dem Tresen stapeln sich die Ausgaben der Taxi Times – der Zeitschrift für das Taxigewerbe. Daneben flattern lose DIN-A4-Blätter, die Uber als den Hauptsponsor der Berlinale verfluchen. Früher war das Berliner Filmfestival das Revier der Berliner Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Aber auch hier wurden sie weggedrängt.
Die Berliner Taxi-Innung, eine von vier Interessenvertretungen des Berliner Taxigewerbes, war mal mächtig. „2.000 Mitglieder zu Zeiten der Wende“, sagt Nadolski. Doch im selben Satz muss er zugeben, dass auch die Innung mittlerweile fast ausgestorben ist: „Knapp 200 Mitglieder haben wir noch.“ Und hätte Nadolski während des Corona-Lockdowns nicht diese geniale Idee gehabt, die seinen Leuten immer mehr Arbeit und ihm selbst immer weniger Schlaf beschert, dann wären es heute vermutlich noch weniger.
Die Idee: Die Taxi-Innung schließt Verträge direkt mit den Krankenkassen ab – damit sich bei Krankenfahrten weder Patienten und Patientinnen noch Fahrer und Fahrerinnen um Anträge oder Abrechnungen kümmern müssen. Die Innung übernimmt den Papierkram.
Das Berliner Taxigewerbe wäre längst tot, hätte den Kampf gegen Uber und Co. schon verloren, gäbe es Nadolski und die Krankenfahrten nicht, sagen seine Kollegen. Wer will, hat seit dieser Idee viel zu tun. Acht, zehn, zwölf Stunden am Tag können die Taxifahrerinnen und Taxifahrer in Berlin kranke Menschen zu Terminen kutschieren.
Doch nicht alle haben Bock darauf.
***
Uwe Jessen zum Beispiel, der nachts am Mehringdamm steht und sich vor Mustafa’s Gemüse Kebab eine Zigarette dreht, während leere Taxis und volle Uber an ihm vorbeifahren.
Krankenfahrten? Die fangen meist früh morgens an, dann müsste Jessen schon um fünf Uhr aufstehen. Lieber beginnt er seine Schicht nachmittags um vier. Arbeiten, wann immer er will, das ist Freiheit. Und die kurzen Strecken, die müssen ja auch gefahren werden, sagt er. Am liebsten fährt er rum und sammelt die Leute direkt von der Straße ein, studiert die Spielpläne der Opernhäuser und Theater, der Konzerthallen und Eventlocations. Bei Fußballspielen fährt er raus zum Olympiastadion.
Mit Krankenfahrten müsste er seinen Traum von Freiheit begraben.
***
Und dann ist da noch Rolf Feja, 66. Groß mit Schnauzbart, ein gemütlicher Berliner Bär. Einer der dienstältesten Kutscher der Stadt, er fährt seit 45 Jahren. Man kennt ihn in Berlin. Feja hat mal Mathe studiert, fuhr Taxi, um sich das Studium zu finanzieren – und blieb dabei. Auch er liebte das Abenteuer, die Freiheit.
Früher fuhr er am liebsten den Ku’damm hoch und runter, da konnte er noch richtig Kohle machen. Doch das ist lange her. Seit die Fahrdienste wie Uber den Markt erobert haben, lebt Feja von Stammkundschaft und Krankenfahrten.
Gerade rollt er mit seinem Elektroauto in die Einfahrt eines Dialysezentrums in Treptow, um die 88-jährige Helga abzuholen. Regen klatscht auf den Asphalt, so als würde ein wütender Nachbar einen Eimer voll Wasser vom Balkon kippen.
Feja steigt aus und stellt sich unter das Vordach, um auf Helga zu warten. Ohne Krankenfahrten hätte er längst hingeschmissen, sagt er.
***
Auf der Website der Taxi-Innung hat Leszek Nadolski einen Liveticker installiert, der zeigt, wie viele Fahrzeuge auf den Straßen Berlins unterwegs sind.
„Taxis in Berlin“ – 5.620
„Mietwagen in Berlin“, also Uber & Co. – 4.388.
Beinahe Gleichstand. Bald haben die Neuen die Alten eingeholt.
Vor fünf Jahren gab es in Berlin noch mehr als 8.000 Taxis und gut 1.800 Mietwagen.
Der Ticker ist Nadolskis Schrei nach Hilfe. Seine Art zu sagen: „Wir sterben.“
***
Während Gundi auf dem Parkplatz vor dem Rehazentrum auf Frau Haag wartet, lehnt sie ihren Kopf an die Fensterscheibe. Draußen ist es viel zu grau und viel zu kalt für diese Jahreszeit. Gundi erinnert sich an die goldenen Taxizeiten, als Firmen wie Uber und Co. noch nicht einmal gegründet waren.
Als Taxifahren noch konkurrenzlos war. Als es den Flughafen Tegel noch gab. Als sie sich dort mit Kolleginnen und Kollegen zum Kaffee traf. Als sie jeden Morgen dort wartete, weil sie wusste: Irgendjemand will bestimmt bis nach Dresden – und sie wird an den langen Fahrten richtig gut verdienen. Bis zu 500 Mark hin und zurück.
***
Im Büro der Taxi-Innung sitzt Leszek Nadolski wieder am dunklen Holztisch. Vor ihm: Papierstapel.
„Buchstabier noch mal“, sagt er zu einem Kollegen.
„Ermeling“, sagt der Kollege.
Nadolski: „Also E, r, m … “.
Der Kollege unterbricht ihn. „Ja, hab ich doch gesagt.“
„Aber die gibt’s nich.“
„Muss es aber.“
„Also ich finde hier keine Frau Ermeling. Wahrscheinlich ist die tot, oder was?“, sagt Nadolski.
„Nein, die ist nicht tot. Ich hab sie doch gestern gefahrn“, sagt der Kollege.
„Ja, ich seh hier die Unterschriften, aber ich finde keinen Patienten, dem wir die Papiere zuordnen können“, sagt Nadolski.
Er sieht erschöpft aus. Dass die Innung die Abrechnungen bei Krankentransporten übernimmt, entlastet zwar die Krankenkassen, die Patienten und Patientinnen – nur Nadolski nicht.
Er sagt, er wolle weniger arbeiten, aber er arbeitet immer mehr. Er sagt, er wisse, dass er sich übernehme. Er sagt, seine Frau sagt, dass er Hilfe braucht. Ja, wahrscheinlich brauche er wirklich Hilfe, sagt Nadolski. Halb scherzend, halb ernst.
Für heute lässt er den Papierkram gut sein. Die Abrechnung von Frau Ermeling sucht er einfach ein anderes Mal. Außerdem muss er sich noch vorbereiten. Am nächsten Tag trifft er Franziska Giffey, die Berliner Wirtschaftssenatorin. Auch das gehört zu seinem Job, neben dem Kleinklein der Abrechnungen – Lobbyist zu sein bei den Mächtigen. Damit es irgendwie weitergeht mit dem Taxileben.
Zu jedem Treffen mit der Politik nimmt er eine Kamera mit. Eine Olympus OM-1 oder eine Canon EOS 700D. Er habe mehrere Kameras. Zum Angeben, sagt er.
***
Der nächste Tag. Das Treffen mit Franziska Giffey steht an. „Wieso muss immer Action sein? Wieso ist es nie entspannt?“, murmelt Nadolski mit vollem Mund in seinen Laptop, Krümel fallen auf die Tastatur. Er beißt in sein Butterbrötchen mit Lachs, dann holt er seine schicken Schuhe aus einem Beutel und schlüpft hinein. Lesebrille in der linken, Mappe mit Unterlagen in der rechten Hand, marschiert Nadolski zusammen mit zwei Kollegen zum Büro der Senatsverwaltung.
Eine Stunde und zwanzig Minuten später sind sie fertig. Nadolski wirkt erschöpft, aber sagt, er sei zufrieden. Zufrieden, dass bald auch in Berlin Festpreise eingeführt werden, damit man vor der Fahrt weiß, wie viel sie kostet. Zufrieden, dass es weiterhin Geld gibt, wenn man sein Taxi zu einem Inklusionstaxi umbauen will, um Menschen mit Rollstuhl leichter befördern zu können. Zufrieden, dass man Zuschüsse erhält, wenn man ein Elektrotaxi kaufen möchte.
Zufrieden. Zufrieden. Zufrieden.
Nur blöd, dass er seine Kamera vergessen hat, weshalb es jetzt nur ein Handyfoto von ihm und Franziska Giffey gibt.
Zurück in der Innung, tauscht Nadolski seine Anzugschuhe sofort gegen Sneaker. Er schaut in die Runde: „Heute könn wir endlich die Sau rauslassen“. Damit meint er das Wildsau-Logo auf einer Weinflasche. Die will er heute Abend noch köpfen. Mit Schuhbeutel in der Hand und Wildsau-Wein unterm Arm marschiert er zu seinem Mercedes. Er muss nach Mitte, eine Patientin von der Dialyse abholen.
Auf dem Weg dorthin an einer roten Ampel hält ein anderes Taxi neben ihm. Nadolski guckt rüber und sagt: „Den kenne ich gar nicht.“
Der unbekannte Taxifahrer lässt die Scheibe herunter: „Da liegt ’ne Kamera bei Ihnen auf dem Dach“, sagt er. „Ach du Scheiße! Zum Glück fahr ich so vorsichtig“, sagt Nadolski, steigt aus, nimmt die Kamera und steigt wieder ein. Die Ampel wird grün. Er fährt weiter. Glück gehabt.
***
In Treptow wartet Rolf Feja noch immer vor dem Dialysezentrum. Als er Helga kommen sieht, hält er ihr die Glastür auf: „Helgachen, komm rin, meine Kleene.“ Sie hakt sich bei ihm unter, gemeinsam gehen sie zur Beifahrertür. Schnell läuft Feja zum Fahrersitz. Nass wird er trotzdem. Auch Helga setzt sich und zieht mit einem pinkfarbenen Ding, das aussieht wie eine Mischung aus Greifzange und Gehstock, die Autotür zu.
Das ist ein Schuhanzieher, sagt sie. Sie habe sich mal beide Schultern gebrochen. Seitdem sei das pinkfarbene Ding ihr ständiger Begleiter. Sie ziehe sich damit die Hosen hoch, die Schuhe an, und auch sonst sei es sehr praktisch. Sie legt ihr Kinn auf dem Ding ab und schaut den Regentropfen hinterher.
Seit drei Jahren fährt Rolf Feja Helga schon zur Dialyse. Sie guckt ihn an. „Ich bin froh, dass ich dich hab.“ „Ach, ist doch gut, Helga“, sagt Feja und macht eine abwinkende Handbewegung. „Am Wochenende mach ich dir was mit Apfel und Streusel. Pflaumenkuchen magste ja nich“, sagt Helga.
Sie biegen in ihre Straße ein. „Ick fahr dich direkt vor die Haustür, dit is ja klar“, sagt Feja und manövriert sein Taxi durch die eigentlich viel zu enge Gasse, so nah wie möglich an Helgas Haustür heran. Er nimmt ihre Hand: „Schönes Wochenende, meine Kleene.“
Als Rolf Feja den Rückwärtsgang einlegt, winkt Helga aus dem Hauseingang. Er wendet und macht sich auf den Weg zum Vivantes-Krankenhaus in Neukölln.
Er fährt jetzt zu seiner eigenen Dialyse.
*Gundi möchte nicht, dass ihr Nachname veröffentlicht wird. Ihr vollständiger Name ist der Redaktion bekannt.
Rolf Feja ist im April gestorben.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








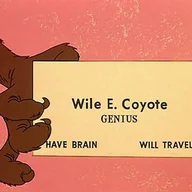

meistkommentiert
Ahmed Mohamed Odowaa
Held von Aschaffenburg soll Deutschland verlassen
Zollstreit mit den USA
Die US-Tech-Konzerne haben sich verzockt
Rechte Politik in Mecklenburg-Vorpommern
Ich will mein Zuhause nicht wegen der AfD aufgeben
Putins hybrider Krieg
Verschwörung, haha, was haben wir gelacht
Streit um Atomkraft
Union will sechs AKWs reaktivieren
Getötete Sanitäter in Gaza
Lügen in Zeiten des Krieges