Proteste und Morales-Sturz in Bolivien: Wir alle waren verliebt in ihn
Evo Morales war mehr als ein Präsident, für die Indigenen Boliviens, für Linke in aller Welt. Jetzt ist er im Exil – und spaltet, statt zu versöhnen.
E s lag etwas in der Luft, sagt die Politikwissenschaftlerin Nadia Guevara. Sie denkt an mindestens drei verschiedene Märsche, die am Sonntag vergangener Woche durch die Stadt La Paz im Westen Boliviens zogen. Einer davon war organisiert für die Rechte der Frauen, ein anderer von den Bergarbeitern aus der Region Potosí, ein weiterer von pensionierten Polizisten. Sie alle richteten sich gegen die Regierung von Boliviens Präsident Evo Morales.
Genau drei Wochen zuvor hatte es Wahlen gegeben, bei denen Morales im Amt bestätigt werden wollte, zum vierten Mal, obwohl die Verfassung nur eine Wiederwahl zulässt. Am Wahlabend sah es so aus, als müsste er in die Stichwahl gegen den Oppositionskandidaten Carlos Mesa. Der würde die Unterstützung der ausgeschiedenen Kandidaten erhalten und die Stichwahl wohl gewinnen. Dann brach plötzlich die Veröffentlichung neuer Wahlergebnisse ab, ohne Begründung.
Er werde mit den Stimmen der ländlichen Provinzen die Wahl noch in der ersten Runde gewinnen, prophezeite Morales. Bei der nächsten Veröffentlichung über 24 Stunden später sagten die Zahlen genau das: Morales hatte mehr als 10 Prozentpunkte Vorsprung und wäre damit Sieger ohne Stichwahl. Gleichzeitig häuften sich Berichte über Wahlbetrug. Von einer „unerklärlichen Trendwende“ sprach die Beobachtermission der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Und im ganzen Land gingen Menschen auf die Straße und protestierten.
An jenem Sonntag vor einer Woche dann die Wende. Am Morgen kündigte Morales Neuwahlen an, sprach von „neuen politischen Akteuren“. „Alle feierten, es war verrückt“, erinnert sich Nadia Guevara. Sie war mittendrin, Fahne in der Hand, das Baby im Tragetuch auf dem Rücken, ihr Mann hatte die Tochter an der Hand. Von der Regierungspartei Movimento al Socialismo (MAS) trat ein Politiker nach dem anderen zurück.
Sie waren gerade zur Haustür herein, da verkündete Morales seinen Rücktritt. Kurz zuvor hatte Militärchef Williams Kaliman den Präsidenten dazu aufgefordert – und Nadia Guevara und ihre Familie kehrten wieder um, sie wollten feiern. „Es war bewegend“, sagt sie. „Alle schrien: Somos libre!“ (Wir sind frei!)
Dann kamen die ersten Nachrichten von Freunden der oberhalb von La Paz gelegenen Nachbarstadt El Alto aufs Handy – und damit die Angst: „Feiert nicht. El Alto brennt.“ „Haut ab mit den Kindern, sie kommen herunter.“ Sie, damit seien die Unterstützer der MAS-Partei gemeint gewesen. Im Fernsehen liefen die ersten Bilder von brennenden Häusern in El Alto und der Zona Sur in La Paz. In der Nacht hörte sie grölende Gruppen ans Metalltor der Wohnanlage schlagen, wo Guevara und 84 andere Familien leben. „Es war eine Horrornacht.“

Seitdem kommen die Menschen nicht zu Ruhe. Auf beiden Seiten. Sebastián González, 18 Jahre alt, will seinen richtigen Namen nicht nennen. Seit Tagen kann er nicht mehr schlafen. Der Musikstudent hat am 20. Oktober für Evo Morales gestimmt, wie die meisten in seiner Familie. Er hat Angst. Um seine Familie, um seine Großmutter und seine Tante, die in El Alto leben. In ihrem Viertel wurde ebenfalls geplündert. „Meine Großmutter ist verängstigt, weil eines ihrer Kinder in Santa Cruz lebt. Sie kamen dort mit Motorrädern und zerstörten die Läden, die einzige Einnahmequelle der einfachen Leute.“ Sie, das sind in diesem Fall die anderen. Die Gegner von Morales, die Rechten, die Polizisten, die sich gegen Morales gestellt haben.
Auf Videos sind weinende, verzweifelte Menschen zu sehen. González hat viele Videos gesehen in den letzten Wochen. „Sie fingen an, die Menschen in El Alto zu beschimpfen, sie seien Schweine, dreckig. Früher waren masistas einfach Anhänger der MAS-Partei, jetzt ist es wie eine Beleidigung“, sagt er. „Hier zeigen die Medien fast nur die Seite der Opposition. Wie die indigenen und ländlichen Gemeinschaften eingeschüchtert werden, zeigen sie nicht.“
Wie alle MAS-Anhänger spricht er von einem Staatsstreich, und wie die meisten in seiner Familie hat er seither alle verräterischen Bilder von seinen sozialen Medien gelöscht, kommentiert nicht mehr und passt auf, was er sagt.
Dieser Artikel wurde möglich durch die finanzielle Unterstützung des Recherchefonds Ausland e.V. Sie können den Recherchefonds durch eine Spende oder Mitgliedschaft fördern.
Sebastián wohnt mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Geschwistern im selben Viertel wie Nadia Guevara, die Politikwissenschaftlerin, vielleicht eine halbe Stunde zu Fuß entfernt. Sein Vater ist Argentinier. Sebastiáns Großeltern waren links und beide engagierte Gewerkschafter in Zeiten der argentinischen Militärdiktatur. Eines Tages gaben sie Sebastiáns Vater und dessen Schwester bei einer Nachbarin ab und baten sie, sie als ihre Kinder auszugeben.

Dann kamen Soldaten, nahmen die Großeltern mit. Sie tauchten nie wieder auf. „Damals wollten sie alle Linken in Südamerika ausrotten“, sagt Sebastián. Sein Vater kam als Kind nach Bolivien, engagierte sich später in linken Bewegungen, gegen Diktatur und Privatisierung. Aus seinen Erzählungen weiß Sebastián, was eine Diktatur ist.
Sebastiáns Großmutter mütterlicherseits ist eine Indigene, eine señora de pollera, wie die Frauen wegen ihrer vielen Röcke genannt werden. Sie lebt heute in El Alto, wo ein Großteil der ärmeren Bevölkerung Evo Morales unterstützt und das wegen Straßenschlachten und Brandstiftungen durch die Medien ging.
Morales gab ihnen Stolz
Ihr Mann verbot der Großmutter, der Tochter ihre indigene Sprache Aymara beizubringen, weil es damals eine Schande war. Später wollten die Großeltern Sebastiáns Mutter nicht studieren lassen – wohl aus Angst, dass sie wegen ihrer indigenen Gesichtszüge an der Uni diskriminiert würde. Genau das passierte. „Als ich im privaten Kindergarten war, gab es dort kaum Kinder mit dunkler Hautfarbe“, sagt Sebastián. Später in seinem öffentlichen Colegio war es umgekehrt. Die öffentliche Schule war genauso gut wie die private. „Aber wenn es um den Eintritt ins Berufsleben ging, blieben die Dunkelhäutigen immer in der Hierarchie zurück“, sagt er.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
„Als Evo Morales Präsident wurde, kam mein kleiner Bruder in denselben privaten Kindergarten. Und Überraschung: Auf einmal kamen Frauen mit polleras und brachten ihre Kinder dorthin. Ich glaube, das änderte sich, weil sie sahen, dass der Präsident auch dunkle Haut hatte, vom Land kam, gelitten hatte – das war ein Symbol, das gab ihnen Stolz. Auch ich fühle mich stolz.“
2003 lag unter Präsident Gonzalo Sánchez de Losada und seinem damaligen Vize Carlos Mesa der Mindestlohn bei 440 Bolivianos. Heute liegt er bei über 2.000, führt er noch an.
Nadia Guevara, 39 Jahre alt, lebt mit ihren beiden Töchtern, ihrem Mann und ihrem Hund im Viertel Sopocachi Alto. Ihre Familie will sie zur Sicherheit nicht in der Zeitung zeigen. Ihr Vater, Hernán Guevara Rivero, war ein indigener Elektriker aus Cochabamba, der sich sein Leben lang in linken Bewegungen und gegen die Diktatur engagierte. Die Familie mütterlicherseits betätigte sich aufseiten der Konservativen.
Guevara bat schon als Kind ihre Großmutter, mit ihr auf Demos zu gehen. Später engagierte sie sich in der Menschenrechtsarbeit. Am letzten Marsch des damaligen Abgeordneten Evo Morales nahm sie teil. Als die Polizei die friedlichen Demonstrierenden angriff, brach sie ihr drei Rippen. Als Morales zum ersten Mal Präsident wurde, sei alles rosarot gewesen. „Wir alle waren verliebt in ihn. Ich mochte die Ideen eines geeinten Boliviens, in dem Indigene eine Stimme haben, wo die Umwelt geschützt wird.“
Während bei Sebastián González die Liebe anhielt, ist sie bei Guevara von der zweiten Amtszeit an erkaltet. „Der indigene Diskurs verschwand, der Antikapitalismus kam. Es ging nicht mehr um Leistung, sondern um Freund oder Feind. Die Partei wurde undemokratischer, Kritiker mundtot gemacht“, sagt Guevara. Als im Sommer in Chiquitanía wochenlang der Wald brannte und der Präsident die Demonstranten, die ein Notstandsdekret zur Rettung forderten, auslachte, reichte es ihr endgültig. Sie ging auf die Straße. Und sie protestierte erneut, als für sie klar war, dass Morales sich nach dem 20. Oktober mit Wahlbetrug zum Sieger erklärte.
Sebastián González blieb zu Hause.
Als am Montag nach Morales’ Rücktritt plündernde Mobs von El Alto nach La Paz zogen, verbarrikadierten sich beide mit ihrer Familie und Nachbarschaft aus lauter Angst im Wohnblock. Als die Armee am selben Tage ankündigte, dass sie die Polizei unterstützen würde, herrschte bei Nadia Guevara Erleichterung und bei Sebastián González blankes Entsetzen: „Ich hatte Angst um meine Freunde und Familie in El Alto, um die Familie meiner Mutter, die auf dem Land lebt. Ich habe gelesen, dass sie in der Geschichte immer die Linken als Erste haben suchen und verschwinden lassen. Unsere Familie in Argentinien sagte: Wenn es schlimm wird, ist hier alles bereit für euch“, sagt Sebastián.
Die Gewaltspirale schraubt sich immer weiter
Dass einige Anhänger der Opposition und Polizisten die plurinationale Fahne Wiphala verbrannten, die die indigenen Wurzeln und die Vielfalt symbolisiert, löste eine Welle an Gewalt aus. Die heißt Sebastián nicht gut, aber er kann sie verstehen.
Angst macht ihm auch das Erscheinen des weißen, bibelschwingenden Unternehmers Luis Fernando Camacho. Der war der Chef eines „Comité Cívico“, eines sogenannten Bürgerkomitees in Santa Cruz, seit jeher die Hochburg der Morales-Gegner. Von dort rief Camacho zum Generalstreik gegen Morales auf, von dort zog er nach La Paz, um provokativ eine Rücktrittserklärung in den Präsidentenpalast zu bringen. „Camacho ist ein Rassist, der zu Gewalt und Diskriminierung der Indigenen aufruft“, sagt González. „Camacho ist ein populistischer Opportunist, für den im Hochland kaum jemand stimmen würde“, sagt auch Guevara.
Die Gewaltspirale schraube sich immer weiter, sagen beide. Die Videos, die WhatsApp-Nachrichten, die Falschmeldungen.
„Jetzt ist der Präsident weg. Es fühlt sich ruhig an. Aber es ist eine ungute Ruhe“, sagt Sebastián González.
„Die Gewalt wird mit noch so viel Tränengas, Polizei und Armee nicht aufhören“, sagt Nadia Guevara. „Beide Seiten müssen sich zusammensetzen und endlich miteinander reden.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










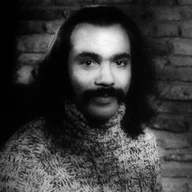


meistkommentiert