Die Streitfrage: „Man muss über alle Götter lachen“
Soll man über höhere Wesen und ihre Propheten Witze machen? Ja, denn keine Unsterblichkeit währt ewig, schreibt der Autor Ralf Husmann.
In seinem Film „Paradies: Glaube“ zeigt der österreichische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Ulrich Seidl eine beharrlich missionierende Katholikin. In der Darstellung ihrer Lebenswelt wählt der Filmemacher drastisch-harte und dunkel-humoristische Methoden – was neben diversen Auszeichnungen eine Anzeige wegen Blasphemie durch die italienische, katholische Organisation „NO 194“ zur Folge hatte. Der NO-194-Präsident meinte, Seidl habe „zwei Milliarden Christen auf der Welt beleidigt“.
Immer wieder führt Spott über Religionen zu einer Debatte – und oft auch zu schweren Ausschreitungen. Als die dänische Tageszeitung Jyllands-Posten 2005 eine Serie von zwölf Karikaturen über den islamischen Propheten Mohammed veröffentlichte, kam es zu internationalen Protesten und Todesfällen.
Die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo gehörte damals zu den Blättern, die die kontroversen Karikaturen aus Verbundenheit nachdruckten, noch erweitert um eigene Zeichnungen. Seit seiner Gründung bekennt sich das religionskritische Magazin zu einer radikalen Form der Pressefreiheit und ließ sich weder von einem Brandanschlag im November 2011 noch von einem anschließenden Hack-Angriff und Droh-Mails einschüchtern.
Das von islamistischen Terroristen verübte Attentat auf die Charlie Hebdo-Redaktion am 7. Januar 2015, bei dem insgesamt zwölf Menschen getötet wurden, erschütterte die Welt. „Je suis Charlie“ wird seitdem auf vielerlei Weise bekundet – jedoch ist auch die Verneinung dieser Aussage zu lesen und hören, von Leuten etwa, die den Terroranschlag verurteilen, den Satirestil von Charlie Hebdo aber ablehnen.

Allmählich zeigt sich, wie brüchig der Pariser Anschlag Frankreich gemacht hat. „Die Muslime werden dafür teuer bezahlen“, sagt Bestseller-Autor Taher Ben Jelloun in der Titelgeschichte der taz.am wochenende vom 17./18. Januar 2015 Und: „Charlie Hebdo“ spottet weiter: ein weinender Mohammed auf der Titelseite, im Heft Scherze über Dschihadisten. Die Streitfrage „Muss man über Religionen Witze machen?“ Außerdem: Keine Angst vor Hegel. „Viele denken, sie müssten das sorgfältig durchstudieren, wie über eine lange Treppe aufsteigen. Ich finde, man kann auch mittendrin irgendetwas lesen.“ Ein Gespräch mit Ulrich Raulff, dem Leiter des deutschen Literaturarchivs in Marbach. Am Kiosk, eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo.
Eine Frage, die in Zusammenhang mit den aktuellen Geschehnissen erörtert wird, ist: Muss man Religionen, ihren Leitfiguren und Anhängern, mit Witz begegnen – und zwar gerade jetzt umso mehr, mit umso beißenderem, böserem Witz? Oder muss man bei Witzen mit religiösen Inhalten Grenzen setzen?
Witze können voller Wahrheit sein
„Wenn man solche Witze machen will, dann mit Respekt vor den Religionen“, schreibt Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, in der taz.am wochenende vom 17./18. Januar 2015. „Witze können erfrischend sein, voller Wahrheit, aber auch beleidigend oder volksverhetzend. Unser Grundgesetz macht die Vorgaben.“ Die 82-Jährige ist überzeugt: „Wenn sich alle danach richten, wird jeder gerne Witze hören und auch lesen.“
Ulrich Seidl, der streng religiös erzogen wurde und eigentlich Priester werden sollte, schreibt hingegen: „In Abwandlung eines Zitats von Ingeborg Bachmann gilt: 'Der Witz ist dem Menschen zumutbar'. Und Religion darf hier keine Ausnahme, kein Tabu sein.“ Für jede Religionsgemeinschaft sei es ein Zeichen der Stärke, wenn sie das Witzeln über sich selbst aushalte. Und: Zwischen Witze machen und Schmähen bestehe ein Unterschied.
Auch Rüdiger Weida, der Vorsitzende des Vereins „Kirche des fliegenden Spaghettimonsters“, und der Drehbuchautor und Schriftsteller Ralf Husmann sprechen sich dafür aus, dass man Witze über Religionen machen muss: „Lachen ist natürlich, vertreibt die Angst und stellt Autoritäten in Frage“, schreibt Weida. „Wo wäre das mehr angebracht als dort, wo erfundene unfehlbare Götter ewige Wahrheiten verkünden und denen drohen, die sich ihnen nicht fügen? Solche Dogmen sind nicht nur gesellschaftsschädlich, sondern auch lächerlich. Im Namen der Freiheit müssen wir uns das Recht vorbehalten, über Lächerliches auch zu lachen.“
Husmann – Erfinder der TV-Serie „Stromberg“ – veranschaulicht seinen Standpunkt in der taz.am wochenende vom 17./18. Januar folgendermaßen: „Mars war früher ein Gott und ist heute ein Schokoriegel. Schwer zu sagen, wie die aktuellen Götter so enden, aber warum soll es ihnen besser gehen, als dem römischen Kollegen? Unsterblichkeit hat noch nie ewig gehalten. Deswegen darf, ja muss man über alle Götter lachen. Und sämtliche Religionen.“ Tue man dies nicht, bliebe „nur all das Elend, das sie seit jeher über die Menschen gebracht haben.“ Und da höre der Spaß dann wirklich auf.
Es geht nicht um Empfindsamkeit, sondern um Macht
Auch die Autorin Karen Duve ist dagegen, Witze über Religionen zu unterlassen: „Es einfach sein zu lassen, könnte als vorauseilender Gehorsam missverstanden werden.“ Schon jetzt bildeten sich viel zu viele religiöse Menschen ein, sie hätten einen Anspruch darauf, dass ihre „reichlich seltsamen Welterklärungsmodelle von Jedermann mit tiefer Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit behandelt werden müssten.“ Duve findet, darin solle man sie nicht auch noch bestärken. Es gehe weniger um Empfindsamkeit als um den „Machtanspruch humorloser Rechthaber.“
Der Psychologe und Soziologe Detlef Fetchenhauer, der sich als „Atheist und überzeugter Liberaler“ bezeichnet, sieht ein „Klima der gegenseitigen Toleranz“ als Ziel: „Man sollte als Atheist Religion nicht bekämpfen, indem man sich über sie lustig macht. Was aber auch gilt: In einer offenen Gesellschaft müssen religiöse Menschen damit leben, dass ihre Überzeugungen nicht Grundlage der säkularen Ordnung sein können. Wer dies nicht akzeptiert, sollte auch mit Spott und Satire auf seine demokratischen Defizite aufmerksam gemacht werden.“
Die Streitfrage „Muss man über Religionen Witze machen?“ beantworten außerdem die Politikwissenschaftlerin und SPD-Politikerin Gesine Schwan, der Regisseur und Drehbuchautor Dietrich Brüggemann („Kreuzweg“), der Professor für Islamische Religionspädagogik Mouhanad Khorchide sowie die taz-Leserin Kerstin Schürfeld – in der taz.am wochenende vom 17./18. Januar 2015.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen












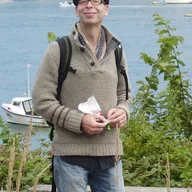

meistkommentiert