Berliner Clubnacht mit 66: Wenn alte Frauen tanzen gehen
Für unsere Kolumnistin ist es sehr besonders, mit 66 in den Club zu gehen und durchzuhalten. Ob die jungen Leute das peinlich oder cool finden? Egal.
M eine Freundin Charlotte hatte zu ihrem 72. Geburtstag wieder eine ihrer unkonventionellen Einladungen ausgesprochen. „Ich will tanzen gehen“, hatte sie verkündet, „in Kreuzberg gibt es am 13. Januar im SO36 die ‚Balkan Beats‘, mit DJ. Da gehen wir hin.“ Und so stehen wir fünf Frauen im SO36 in Berlin-Kreuzberg in der Garderobenschlange, verwaschene Stempel von der Eingangskontrolle auf den faltigen Handgelenken. Acht Euro kostet der Eintritt in den etwas verranzten Laden.
Um uns herum drängen lauter 20-, 25-Jährige in dunklen Klamotten zur Garderobe. Ich fühle mich plötzlich beschwingt, nicht nur, weil es für mich mit 66 Jahren was Besonderes ist, an einem Werktag erst um Mitternacht auszugehen und das körperlich noch durchzuhalten. Hier fallen wir auf wie fünf bunte Hunde. Hinter uns in der Schlange unterhalten sich zwei junge Männer. „Ist heute Großmuttertag?“, fragt der eine seinen Kumpel. Ich könnte mich jetzt empört umdrehen und einen Monolog halten. Etwa so:
„Hör mal, junger Mann, ich bin in diesen Laden hier schon vor 45 Jahren gegangen, mit 21, da warst du noch nicht mal gezeugt! Ich habe um die Ecke in einer Fabriketage gewohnt, für 120 Mark im Monat, im Winter froren die Wasserleitungen zu, wir haben das Eis mit einem Bunsenbrenner wiederaufgetaut. Unter uns lebte ein Junger Wilder, der seine überdimensionierten Gemälde zur Ausstellung ins SO36 schleppte.“
Klingt super, nur ist es leider lächerlich, mit der Vergangenheit, die man leistungslos erlebt hat, angeben zu wollen. Außerdem klang der junge Mann ganz nett, als fände er uns vor allem exotisch. Was verständlich ist, denn in späteren Jahren schaffen es die Leute bestenfalls nur noch zum Tangokurs, in Clubs geht kaum noch einer ab 65.
Wie in der Seniorengymnastik
Wir stehen jetzt im Innenraum im SO36, Balkan-Pop entspannt, manchmal erklingt ein Fünfvierteltakt. Wir bewegen uns im Takt hin und her, es ist ein sanftes Schaukeln. Ich fühle mich ein bisschen wie beim Balancekurs in der Seniorengymnastik, den ich besuche, weil mir neuerdings so leicht schwindlig wird. Eine junge Frau wirft uns einen Blick zu und grinst. Sehe ich Mitleid in ihren Augen oder findet sie uns supercool? Keine Ahnung.
Es ist jedenfalls nett hier. Die Luft ist besser als vor 45 Jahren. Wie hatte ich das damals nur ausgehalten, in dieser Rauchbude? Na ja, ich hatte selbst geraucht. Zwei Gläser Wein, das Getanze und die späte Stunde reichen schon, um mich besonders zu fühlen. Um zwei Uhr nachts gehen wir zur U-Bahn am Kotti. Auf der Straße stehen noch ein paar junge Menschen mit Drinks in der Hand, trotz der winterlichen Temperaturen, und genießen ihr Coolsein. „Eigentlich ist es nicht viel anders als früher“, sage ich, und der Gedanke beruhigt mich. „Aber heute fährt nachts die U-Bahn durch“, bemerkt Charlotte. Es gibt noch Verbesserungen, auf jeden Fall.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







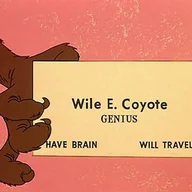




meistkommentiert
Bürgergeld-Populismus der CDU
Die Neidreflexe bedient
Verkehrsranking
Das sind die Stau-Städte
Anbiederungen an Elon Musk
Der deutsche Kriecher
Pressekonferenz in Mar-a-Lago
Trump träumt vom „Golf von Amerika“
Habeck-Werbung in München
Grüne Projektion
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Eine Frage des Vertrauens