Antisemitismus-Resolution im Bundestag: Kritik an Antisemitismus-Resolution
Kurz vor Abstimmung streiten Bundestagsabgeordnete über die sogenannte Antisemitismus-Resolution. Widerstand kommt auch von Teilen der Grünen.

Kurz bevor der Bundestag am Donnerstag die umstrittene sogenannte Antisemitismus-Resolution verabschieden will, kracht es. Die Unionsfraktion forderte in einem Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, ihre Vizepräsidentin Aydan Özoğuz möge am Tag der Abstimmung nicht das Plenum leiten. Vergangene Woche hatten Unionsabgeordnete bereits ihren Rücktritt gefordert.
Die SPD-Politikerin hatte Mitte Oktober einen Zionismus-kritischen Post der Organisation „Jewish Voice for Peace“ in ihrer Instagram-Story geteilt. Özoğuz hatte sich dafür entschuldigt. Sie habe auf das zivile Leid beider Seiten aufmerksam machen wollen. Auf taz-Anfrage heißt es zudem aus ihrem Büro, der Sitzungsplan habe von Anfang an Bärbel Bas als Sitzungsleiterin vorgesehen.
Die sogenannte Antisemitismus-Resolution hat das Ziel, jüdische Menschen in Deutschland besser zu schützen. Seit dem 7. Oktober 2023 ist die Zahl der antisemitischen Übergriffe in Deutschland stark gestiegen. So fordert die Resolution etwa, dass keine staatlichen Gelder an Organisationen gehen dürfen, die Antisemitismus verbreiten.
Umstrittene Definition
Was dabei antisemitisch ist, dafür soll die sogenannte IHRA-Definition maßgeblich sein. Diese wird von einigen Regierungen verwendet, ist aber umstritten, weil sie Antisemitismus weit fasst. Kritiker:innen fürchten, dass sie so ausgelegt werden kann, dass darunter legitime Kritik an Israels Regierung fallen könne. Außerdem wird in dem Text ein Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Antisemitismus hergestellt und neben diesem auch Antiisraelismus als Problem dargestellt.
Konstantin Kuhle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP, sieht laut einer Mitteilung in der Resolution „ein klares Zeichen, den Antisemitismus in unserem Land wirksam und nachhaltig zu bekämpfen.“ Kritiker:innen hingegen bemängeln die Ankündigung im Text, „repressive Möglichkeiten konsequent auszuschöpfen“.
Auch von den Grünen, der SPD und Opposition gibt es laute Kritik an der Resolution. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram teilte mit, dass sie gegen den Antrag stimmen werde. Er ignoriere „die Debatte, in der Jurist*innen, jüdische Intellektuelle, israelische Menschenrechtsorganisationen, Kulturschaffende & Wissenschaftler*innen aufgezeigt haben, welche Probleme“ durch die Verabschiedung der Resolution entstehen würden. Sie widerspreche wissenschaftlichen Standards. Das bestärkten am Mittwoch Wissenschaftler:innen in der Bundespressekonferenz.
Vor wenigen Tagen gab es bereits ablehnende Stimmen aus Reihen der SPD-Fraktion. Sowohl Isabel Cadematori als auch Nina Scheer forderten eine Überarbeitung der Resolution. Cadematori wendete sich mit einem Schreiben an die Fraktionsspitze. „Da der Antragstext bis letzten Freitag geheim verhandelt worden ist und bis Sonntag der gesamten Fraktion nicht vorgelegt wurde, konnte eine notwendige kritische Debatte nicht stattfinden“, heißt es darin.
Laut Scheer enthält die Resolution Aussagen, die sie „sowohl in rechtlicher als auch politischer Hinsicht für falsch und nicht tragbar“ hält. Auch die ehemalige SPD-Justizministerin Herta Däubler-Gmelin kritisierte die Resolution. In einem Brief an die Fraktionsspitze warb sie dafür, gegen die Resolution zu stimmen.
Kritik kommt auch aus der Opposition. Nicole Gohlke, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, teilte auf Anfrage der taz mit, dass sie gegen die Resolution stimmen würde. Statt Antisemitismus zu bekämpfen, würde sie dazu beitragen, die Freiheit von Wissenschaft und Kunst „massiv einzuschränken, Vorurteile gegen Menschen mit Einwanderungsgeschichte weiter zu schüren sowie Kritik an Israels Regierung und der Besatzungspolitik zu delegitimieren.“ Es sei falsch und gefährlich, die Pluralität der jüdischen Community in Deutschland, genauso wie die der israelischen Gesellschaft auszublenden.
Die Linkspartei hat indes den Vorschlag gemacht, anstelle des vorliegenden Entwurfs den Alternativvorschlag, den eine Wissenschaftler:innengruppe Mitte Oktober in der FAZ veröffentlicht hatte, zur Basis einer Resolution zu machen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





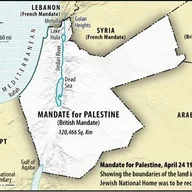



meistkommentiert