Zeichen gelungener Integration: „Moscheen müssen sichtbar sein“
Der Hamburger Architekt Joachim Reinig plädiert dafür, nicht mehr genutzte Kirchen abzureißen und auf den freiwerdenden Grundstücken Moscheen zu errichten.

taz: Herr Reinig, warum machen Sie sich als fortschrittlicher Zeitgenosse für Moscheen stark – und nicht für säkulare Orte?
Joachim Reinig: Säkulare Orte sind ja unumstritten, klassischerweise die Museen als Orte der Selbstreflexion. Ich habe mich vor einigen Jahren stark gemacht für die Gründung eines Einwanderermuseums in Hamburg. Auf der Veddel gibt es schon ein Auswanderermuseum, aber die Geschichte der Einwanderer, der „Gastarbeiter“ muss jetzt dokumentiert werden, solange sie noch leben.
Was ist daraus geworden?
Es gab viele Unterstützer, aber die Kulturbehörde hat die Initiative leider nicht mitgetragen.
66, der Dombaumeister und Michel-Architekt engagierte sich u.a. beim Aufbau des alternativen Mietervereins „Mieter helfen Mietern“ und der Stadtentwicklungsgesellschaft „Stattbau Hamburg GmbH“, die viele Wohnprojekte ermöglichte. 2008 wurde er in die europäische Vereinigung der Dombaumeister berufen. Er saniert derzeit Hamburgs Gängeviertel.
Und warum nun Moscheen?
Man sollte den Glauben nutzen und ihn für Integration aktivieren. Als jemand, der viele Kirchen saniert, glaube ich, dass das für die Gesellschaft wichtige Orte sind: Damit das Leben nicht nur vom Geld und der Arbeit bestimmt wird. Die Kirche schafft einen Bruch im Alltag, man kommt zur Ruhe, kann sich seiner selbst erinnern und reflektieren. Das ist die Aufgabe von Religion und in dieser Hinsicht ähnelt sie derer des Museums.
Sind Sie religiös?
Ich bin getauft, konfirmiert und war zehn Jahre lang in einem Sufi-Orden. Ich kenne also mystische Wege der Religion und habe dabei viel gelernt. Mir ist aber bewusst geworden, dass die Aufklärung unsere europäische Kultur ist: Das ist das Wesentliche, was uns hier auszeichnet.
Widerspricht es dem Geist der Aufklärung, sich für mehr religiöse Orte einzusetzen?
Jeder soll nach seiner Façon selig werden. Ich glaube, in dieser durchorganisierten Gesellschaft, in der wir heute leben, in der viele Leute hart um ihre Existenz kämpfen müssen, ist es wichtig, dass Kirchen, Moscheen und Synagogen zeigen: Ihr werdet angenommen, auch ohne etwas zu leisten – als Menschen, so wie ihr seid.
Ihr Engagement für den Moschee-Bau ist also durchaus ein Statement?
Was ich gelernt habe, ist, dass wir Moscheen brauchen, weil sie Zugang haben – zu Familien, aber auch zu vielen Jugendlichen, die durchaus hier und da Probleme machen, weil sie Probleme haben. Die Moscheegemeinden leisten eine aktive Integrationsarbeit für Menschen, die die staatlichen Stellen nicht erreichen. Insofern sind Moscheen ein positiver Faktor für die Integration von Migranten, auch für die, die jetzt als Flüchtlinge dazukommen.
Ist das wirklich Integration oder eher ein Versuch, die angestammte Art der Lebensführung fortleben zu lassen?
Meine Grundthese ist, dass das Entstehen von Moscheen ein Zeichen der Integration ist – und nicht der Segregation. Eine Integration in der Fremde ist dann möglich, wenn man um seine Herkunftskultur und Familiengeschichte keine Angst zu haben braucht. Daraus leite ich als Architekt und Stadtplaner ab, dass die Moscheen sichtbar sein müssen. Das sichtbare Minarett in einer modernen Architektur ist die Botschaft an die Migranten: Ihr gehört dazu und müsst den Verlust eurer Identität in dieser Gesellschaft nicht fürchten.
Warum ist das ein Zeichen der Integration?
Nehmen wir die türkischen Migranten, die als Gastarbeiter aus Anatolien gekommen sind: Die sind relativ säkular gewesen, waren zwar aus Tradition Muslime, haben den Islam oft aber gar nicht praktiziert. Sie haben hier gelebt mit der Vorstellung, irgendwann zurückzugehen. Nachdem sie hier Kinder und Enkel bekommen haben, haben sie die Entscheidung getroffen, hier zu bleiben. Im gleichen Augenblick haben sie sich an ihre Religion erinnert und es entstanden die vielen islamischen Gemeinden in Hamburg. Der Wunsch, deutscher Staatsbürger zu werden und die Aktivierung ihres Glaubens liefen parallel.
Sie werden Michel-Architekt genannt, weil sie die Hamburger St. Michaeliskirche saniert haben. Wie kamen Sie überhaupt zur Moschee?
Ich wurde Mitte der 90er-Jahre von Freunden in Hamburg-St. Georg gebeten, der türkischen Gemeinde in der Böckmannstraße zu helfen. Sie hatten ein Nachbargrundstück von Mercedes Benz gekauft und ein großes Problem mit der Entwicklung dieses Geländes, sie hatten kein Baurecht. Sie bekamen es, weil Mercedes Geschäfte in der Türkei machen wollte. Ich habe damals mitgeholfen, einen städtebaulichen Vertrag auszuhandeln und eine Moschee zu planen. In einem „St. Georg Dialog“ wurden die Pläne diskutiert und in den Stadtteil eingebunden. Das hat viele Jahre gedauert und ist dann nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gescheitert, weil keine Bank das Projekt finanzieren wollte.
Ereignisse, die im Zusammenhang mit islamistischem Terror stehen, führen also unmittelbar zu Rückschlägen für die muslimische Gemeinden?
Ja, mit Sicherheit. Die Gemeinden stehen sehr stark unter Druck, weil das oft mit ihrer Arbeit verwechselt wird und sie unter einem ständigen Rechtfertigungsdruck stehen. Dabei gibt es in Hamburg 42 muslimische Gemeinden, die ein ganz normales Gemeindeleben führen – weit weg von jedem Terror.
2013 haben Sie die Situation von Moscheen und Gebetsräumen in Hamburg untersucht. Mit welchem Ergebnis?
Unser Gutachten besagt, dass an sieben Standorten der dringendste Bedarf besteht. In der aktuellen Debatte wurde daraus gemacht: „Die Grünen-Politikerin Stefanie von Berg fordert eine Moschee in jedem Stadtteil.“ Die Frage ist aber, wo gibt es überhaupt Standorte für Moscheen. Den ersten Vorschlag machten wir für Wilhelmsburg als Ort für eine Stadtteilmoschee. Die ist nicht „gigantisch“, wie geschrieben wurde, sondern nur ein Drittel so groß, wie das benachbarte Berufsschulzentrum. Das ist auch erst mal nur ein Vorentwurf.
Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben jede der 42 Moscheen erfasst, mit Außenbild und Innenbild, haben dokumentiert, in welcher Sprache gepredigt wird. Wir haben uns auch angeschaut, ob sie Frauen- und Kinderarbeit machen und wofür sie Flächen brauchen, zum Beispiel für Nachhilfe und Bildungsarbeit für Jugendliche. Es geht uns um reine Empirie: Wie viele Quadratmeter haben sie jetzt, was ist der konkrete Bedarf und woran scheiterten bisher ihre Baupläne? Aber wir sind tiefer eingestiegen und haben geschaut, wie engagiert sind die Ehrenamtlichen, wer trägt die selbst organisierte und finanzierte Gemeindearbeit?
Wer hat Sie beauftragt?
Der Hamburger Senat hat mit der Schura, der türkischen Religionsanstalt Ditib und dem Verein der türkischen Kommunikationszentren und der Ahmadiyya-Moschee über einen Staatsvertrag verhandelt. Das hatte 2006 der damalige Bürgermeister Ole von Beust angestoßen. Die Moscheen beklagten in diesen Gesprächen, dass es Restriktionen für Moschee-Standorte gibt und dass sie keinen Platz, aber einen erheblichen Bedarf haben. Der Senat regte an, das zu untersuchen. Im Staatsvertrag ist vereinbart worden, die Verbände bei der Entwicklung neuer Moscheen zu fördern. Dann haben uns die Verbände beauftragt, ein Gutachten zur räumlichen Situation aller 42 Hamburger Moscheen zu erstellen.
Aber eine salafistische Moschee in Wilhelmsburg haben Sie ausgeklammert.
Sie gehört zu keinem Verband, wir haben sie nicht untersucht.
Gibt es große Unterschiede hinsichtlich des sozialen Engagements in den Gemeinden?
Die afrikanischen Moscheen machen viel Bildungsarbeit, die haben richtige Klassenräume. Viele bieten Essen, Sozial- und Eheberatung an. Migranten haben genau die gleichen Probleme wie Deutsche, Ehe- und Erziehungsprobleme, Gewalt in der Familie oder Geldnöte.
Wie viele Leute beten in Hamburgs Moscheen?
Die Größenordnung beim Freitagsgebet ist vergleichbar mit dem Sonntagsgottesdienst christlicher Kirchen. Die Kirchen beziffern das nicht so genau, aber es sind etwa drei Prozent der Christen, die zur Kirche gehen. Das wären 23.000 Menschen in Hamburg, bei den Moscheen sind es etwa 17.000.
Viele Muslime beten in Tiefgaragen oder Kellern. Werden Moscheen an den Rand der Gesellschaft gedrängt?
Ja, das sind völlige Nischenlagen. Die Gemeinden haben geschaut, woher kriegen sie überhaupt Flächen, die sie bezahlen können. An der Schilleroper…
…einem leer stehendem ehemaligen Theater…
…hat eine Gemeinde in einem weißen Eckgebäude zwei Wohnungen gemietet und einen Durchbruch durch die Wand gemacht. Auf der Veddel sitzen sie in einem alten Laden, den ihnen das städtische Wohnungsunternehmen Saga vermietet hat. Nach außen hin sind Moscheen und Gebetsräume oft nur durch ein Schild erkennbar.
Warum ist es so wichtig, dass repräsentativer gebetet wird?
Wo gebetet wird, ob im Hinterhof oder in der allerschönsten Moschee, ist sicherlich für Gott ziemlich egal. Das Gebet hat überall seine Gültigkeit. Es geht darum, wie wir als Gesellschaft damit umgehen: Ob wir den Menschen, die sich gemeinsam zum Gebet treffen wollen, Entwicklungsspielraum zugestehen. Wir haben wunderschöne Kirchen, das sollten wir auch anderen Religionen zubilligen.
Glauben Sie nicht, dass es vor allem daran liegt, dass es in Hamburg an Flächen mangelt?
Nein, allein die Kirchen, die aufgegeben werden, bieten jede Menge Platz. Der Kirchenkreis Hamburg-Ost schätzt, dass von den 160 Kirchen ein Drittel aufgegeben werden muss. Also hat man rein theoretisch 50 Standorte.
Halten Sie es nicht für gewagt, ausgerechnet Kirchen umzunutzen – immerhin hängen daran viele Emotionen?
Wenn Kirchen umgenutzt werden, finde ich das problematisch. Das Modell der Kapernaumkirche, die als Al-Nour-Moschee genutzt wird, sollte eine Ausnahme bleiben. Dass aber Kirchen, die von Gemeinden aufgeben werden, abgerissen werden, finde ich hinnehmbar. Am besten wäre es, dort mit den Kirchengemeinden Moscheestandorte zu entwickeln. Juden, Christen und Muslime sind als abrahamitische Religionen theologisch Brüder und Schwestern und haben viele Gemeinsamkeiten, sie sollten keine Berührungsängste haben.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






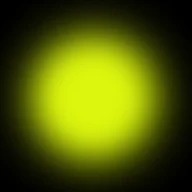
meistkommentiert
Grünen-Pläne zur Krankenversicherung
Ohne Schutzschild aus der Deckung
Anklage gegen Linke Maja T. erhoben
Ungarn droht mit jahrelanger Haft
Abstoßender Wahlkampf der Rechten
Flugticket-Aktion sorgt für neue Forderungen nach AfD-Verbot
Erneuerbare Energien
Die bizarre Aversion der AfD
Sozialwissenschaftlerin Ilona Otto
„Klimaneutralität würde uns mehr Freiheiten geben“
Debatte über Staatsbürgerschaft
Sicherheitsrisiko Friedrich Merz