Wiederaufbau der Garnisonkirche: Turmbau zu Potsdam
Nach jahrzehntelangem Streit eröffnet Bundespräsident Steinmeier den Turm der Garnisonkirche. Er soll für Versöhnung und Frieden stehen.

Es ist kein einfacher Termin, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Potsdam vor sich hat. Zur Eröffnung der wiederaufgebauten Garnisonkirche sprechen, eines Gebäudes also, das weithin als Symbol für die schlimmste Zeit der deutschen Geschichte gilt. Steinmeier aber hat die Schirmherrschaft für den umstrittenen Bau übernommen, und so ist er an diesem Donnerstag die paar Kilometer aus Berlin gekommen, um im Kirchturm die Festrede zu halten.
Von einem „guten Anfang auf altem Grund“ spricht Steinmeier in der Kapelle und von einer barocken Fassade, die „mit viel Geschichte beladen“ sei. „Gerade hier werden wir schnell auf schmerzhafte, unheilvolle Teile unserer Vergangenheit stoßen.“
Tatsächlich muss man die positiven Stellen in der Geschichte der Kirche mit der Lupe suchen. Von Anfang an Ausdruck der engen Verbindung von aggressivem Nationalismus, Militarismus und der evangelischen Kirche in Preußen, wurde der Bau 1933 zur Bühne für den symbolischen Handschlag von Reichspräsident Paul von Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler. Im Krieg schwer beschädigt, ließ die DDR die Ruine schließlich sprengen. Die Initiative für den Wiederaufbau kam ab den 80er Jahren zunächst aus rechten Kreisen. Nun, über 30 Jahre später, also die Eröffnung des Turms.
Dass es bis heute viele in Potsdam gibt, die den Wiederaufbau ablehnen, merkt man auch am Donnerstag. Einige hundert Demonstrant*innen haben sich vor dem Kirchturm versammelt. In den ersten Minuten von Steinmeiers Rede dringen ihre Sprechchöre sogar durch die dicken Mauern in die Kapelle.
Steinmeier hält ihnen entgegen: „Ein Ort, der nicht mehr da ist, würde das kritische Erinnern nicht leichter machen.“ Gleichzeitig sagt er auch: „Die Debatte um die Garnisonkirche ist Ausweis eines kritischen Geschichtsbewusstseins.“ Zeitweise wirkt es so, als wäre er den Protestierenden fast dankbar.
Ein Demonstrant
Auch die anderen Redner*innen, wie Bischof Christian Stäblein und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), geben sich sichtlich Mühe, Position gegen Militarismus, Nationalismus und Geschichtsrevisionismus zu beziehen. Stäblein will den Turm als „Ort der Wachsamkeit“ gegen rechte Ideen begriffen wissen. An der Decke hängen Origami-Tauben, und eine Gruppe Schüler*innen trägt eine Performance vor mit dem Titel „Frieden ist…“.
Dieser Botschaft gegenüber steht ein Teil der Menschen auf der Gästeliste. In der Kapelle sitzt neben Polit- und Kirchenprominenz auch der umstrittene Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen, direkter Nachfahre von Kaiser Willhelm II. Bis März 2023 versuchte er, die durchaus bedeutende Rolle seiner Familie, der Hohenzollern, beim Aufstieg der Nazis zu beschönigen, um enteignete Besitztümer zurückzubekommen.
Im Kirchturm ist zwischen Kapelle und Aussichtsplattform auch eine Ausstellung untergebracht. Nach allen Regeln der Kunst moderner Museumspädagogik wird auf der dritten Etage der historische Kontext der Garnisonkirche dargestellt. Ein touristischer Hotspot war die Kirche im 19. Jahrhundert, erfährt man. Besucher:innen strömten in die Kirche, vor allem, um die sterblichen Überreste des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., der den Bau der Kirche einst in Auftrag gab, und dessen Sohns, Friedrich II. („der Große“), in Augenschein zu nehmen, die in der Gruft begraben lagen. „Für deutsche Nationalpatrioten ist der Besuch vor diesem Hintergrund nahezu obligatorisch“, heißt es in der Ausstellung, schon weit vor der NS-Zeit.
So wird ersichtlich, wie sich preußischer Militarismus und Christentum miteinander verbanden. Immer wieder nimmt die Ausstellung auf die deutsche Kirchengeschichte Bezug, erklärt detailliert die Rivalität zwischen der „Bekennenden Kirche“ und den „Deutschen Christen“, die sich positiv auf den Nationalsozialismus bezogen, und spart auch die Umweltbewegung in der DDR nicht aus – zwei Aspekte, die freilich nur bedingt mit der Garnisonkirche in Zusammenhang stehen.
Es dauert eine Weile, bis die NS-Zeit und der folgenschwere „Tag von Potsdam“ 1933 behandelt werden. Ein alter RBB-Beitrag verdeutlicht die Bedeutung des Handschlags zwischen Hitler und von Hindenburg, zitiert Letzteren, der sich wünscht, der Geist der alten preußischen Ruhmesstätte möge auch „das heutige Geschlecht beleben“. Im Überblickstext eingangs der Ausstellung fehlt der Hinweis auf die zwölf NS-Jahre zwischen Preußenreich und der Sprengung der Kirche durch die DDR-Regierung 1968.
Die ist im letzten Ausstellungsraum ausführlich Thema, bevor es an den Wiederaufbau geht. Dass der durchaus umstritten ist, lässt sich an den Infotafeln an der Wand nachlesen. Ein Zitat des Historikers Martin Sabrow, wonach Befürworter:innen und Gegner:innen des Wiederaufbaus mehr vereint als trennt – beide würden sich „aus Furcht vor der Zukunft an das, was gewesen ist“, klammern – unterstreicht den Anspruch von Kurator Jürgen Reiche, sich nicht von einer Seite vereinnahmen zu lassen.
Dem Zitat Sabrows ist eins von Oberstleutnant a. D. Max Klaar zur Seite gestellt, der den Wiederaufbau einst angestoßen hatte. Dass es sich bei Klaar um einen Rechtsradikalen handelt, ist auf den ersten Blick allerdings nicht ersichtlich.
Wer sich für Feinheiten interessiert, kann in einem Ordner mit Zeitungsartikel blättern. Die skandalträchtige Aufstellung des Glockenspiels findet immerhin noch Platz auf der Wand, bevor die letzte Tafel der Ausstellung die Wichtigkeit der Bundeswehr in Zeiten aktueller Bedrohungslagen würdigt.
Dass die heutigen Militärs nach wie vor an der Garnisonkirche interessiert sind, zeigt sich am Donnerstag deutlich. Zwischen dem Dunkelblau der vielen Anzüge sticht im Publikum immer wieder das Feldgrau der Bundeswehr-Paradeuniformen durch.
Als Anzugträger, Militärs und schließlich auch Steinmeier aus dem Turm treten, schreien ein paar Gegendemonstrant*innen der Initiative „Für ein Potsdam ohne Garnisonkirche“ ihm und seiner Entourage „Heuchler“ entgegen und: „Schämt euch“. Der taz sagt eine von ihnen: „Ich verstehe nicht, woran man hier positiv erinnern will“, die Kirche sei immer nur dazu da gewesen, „Soldaten auf den Krieg vorzubereiten“. Und ein Mann mit schwarzem Pulli neben ihr meint mit Blick auf den Turm: „Meine Hoffnung ist, dass es ein Insolvenzprojekt wird.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






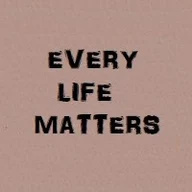


meistkommentiert