Verfassungsgericht zu Feiertagsschutz: Ein Heidenspaß
Tanzen als politischer Protest muss möglich sein. Es darf am Karfreitag nicht grundsätzlich verboten sein, urteilt das Bundesverfassungsgericht.

Geklagt hatte der Bund für Geistesfreiheit, eine bayerische Organisation mit knapp 5.000 Mitgliedern, die sich für die Trennung von Kirche und Staat einsetzt und Privilegien der Kirche kritisiert.
Zum Karfreitag 2007 luden die Freidenker unter dem Motto „Heidenspaß statt Höllenqual“ ins Münchener Oberangertheater. In ihrer „Religionsfreien Zone München“ sollte es eine atheistische Filmnacht („Freigeister-Kino“), ein Pralinenbuffet und am Ende einen „Freigeister-Tanz“ mit der Rockband „Heilig“ geben. Wie erwartet verbot die Stadt die abschließende Tanzveranstaltung, weil sie gegen das bayerische Feiertagsgesetz verstoße.
Dieses Gesetz benennt neun Feiertage (vom Karfreitag bis zum Totensonntag) als „Stille Tage“, an denen nicht nur die Läden geschlossen bleiben, sondern auch Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen grundsätzlich verboten sind. Die Kommunen können zwar Ausnahmen zulassen – „nicht jedoch für den Karfreitag“, heißt es im bayerischen Gesetz. Das geht zu weit, entschied jetzt der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts.
Die Versammlungsfreiheit ist wichtiger
Zumindest für Veranstalter, die sich auf die Versammlungs- und Weltanschauungsfreiheit berufen, müsse es auch am Karfreitag möglich sein, Unterhaltungsveranstaltungen durchzuführen. Wer also aus politischen Gründen gegen das Tanzverbot am Karfreitag demonstrieren will, muss auch am Karfreitag demonstrativ tanzen dürfen. Die Heidenspaß-Party hätte deshalb nicht verboten werden dürfen – zumal sie als Veranstaltung im geschlossen Raum wenig Störung für andere verursacht hätte.
Die Verfassungsrichter nutzten den Fall zu einem Grundsatzurteil über den Feiertagsschutz im weltanschaulich neutralen Staat. So dürfe der Staat durchaus christliche Festtage als staatliche Feiertage ausweisen und auch als „Stille Tage“ definieren.
Der Staat dürfe mit den Feiertagen aber nur einen „Rahmen“ zur Verfügung stellen, den jeder Bürger selbst füllen kann, entweder zur Erholung oder zur religiösen Erbauung. Der christliche Teil der Bevölkerung habe dabei keinen Anspruch, an solchen Tagen nicht mit anderen Religionen oder Weltanschauungen konfrontiert zu werden. (Az. 1 BvR 458/10)
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





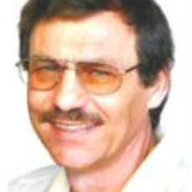

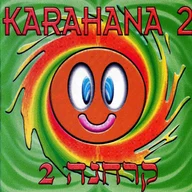

meistkommentiert
Demonstration für Lorenz A.
Eine Stadt trauert
Essay zum Tod von Lorenz A.
Die Polizei ist eine Echokammer
AfD-Verbot kann kommen
Da braucht es weder Gutachten noch Verfassungsschutz
BSW-Parteitag in Thüringen
Katja Wolf setzt sich wieder durch
Schicksal vom Bündnis Sahra Wagenknecht
Vielleicht werden wir das BSW schon bald vermissen
Friedensverhandlungen Ukraine
Trump und Selenskyj treffen sich in Rom