Nach dem Berliner Anschlag: Die heiligen drei Herren
Ideologie, Ökonomie, Besäufnis: Der Weihnachsmarkt ist ein Bollwerk deutscher Leitkultur. Seit dem Anschlag steht er nicht mehr für Frieden auf Erden.
Weihnachtsgeschichten handeln von Elend, Grausamkeit, Mord und Heimatlosigkeit, Nirgendwo wird die Welt in so düsteren Farben gemalt wie in Weihnachtsgeschichten. Damit dann der Glanz der Gnade, der Widerschein himmlischer oder wenigstens familiärer Harmonie umso stärker zur Geltung kommen kann.
Ich weiß nicht, sagte Herr Reiner, der Mühe hatte, sich von der Menschenmenge nicht an eine Hauswand drücken zu lassen, wann sich die Erzählrichtung unserer Weihnachtsgeschichten umgedreht hat. Dergestalt, dass sich in einem allfälligen Glanz von Überfluss und Überdruss ein Abdruck der Hölle zeigen muss, damit wir noch glauben. Wir leiden, pflichtete sein Freund Herr Kainer bei, unter der Marktförmigkeit unseres Weihnachtsfestes. Dagegen gibt es nur ein Mittel. Genau, sagte Herr Reiner, den Weihnachtsmarkt.
Wobei es, meinte Herr Kainer, nachdem es ihm mit Mühe gelungen war, einem mürrischen alten Mann mit Mitra und Bischofsstab auszuweichen, nicht ausgemacht ist, ob wir uns hier im Glanz kommender Harmonie oder doch im Widerschein der Hölle befinden. Ob es nun, entgegnete sein Freund, der Himmel oder die Hölle ist, die man hier erahnt, fest steht, dass es unsere Himmel und Höllen sind, deutsche Himmel und Höllen, ja, Weihnachten gewordene Deutschheit, und darauf kommt es an.
So trafen der Herr Reiner und der Herr Kainer schließlich ihren „Dritten im Bunde“, den Herrn N’Bembé, dem sie leichtsinnigerweise versprochen hatten, bei der Besichtigung eines deutschen Weihnachtsmarktes behilflich zu sein. Dabei hatten sie ihm erklärt, dass es zwar in gewissen Städten durchaus schon früher Weihnachtsmärkte gegeben hatte, auf denen man sich Christbaumschmuck, Krippenfiguren, Lebkuchen und andere Spezialitäten kaufen konnte. Die inflationäre Ausbreitung der Weihnachtsmärkte, vor allem aber ihre gleichförmigen Anordnungen um Glühweinstände herum, an denen von ziemlich früh bis ziemlich spät lautstark und geruchsintensiv deutscher Vorweihnachtlichkeit gehuldigt wird, sei ein neueres Massenphänomen sowie eine sonderbare symbolische Aufladung.
Flucht zum Glühweinstand
Auf dem Weihnachtsmarkt möchte das deutsche Volk unter sich sein, und das ist es immer am liebsten, wenn es jemanden hat, dem man unterstellen kann, dass er es einem missgönne. Man hüte sich also, sagte Herr Kainer (und Herr N’Bembé tat sich einmal mehr schwer damit, zu bestimmen, wie ernst es seinem Freund mit dieser Aussage war), vor abfälligen Äußerungen auf einem deutschen Weihnachtsmarkt, weil man hier gern einmal gleich doppelt gekränkt ist, einmal in vorweihnachtlichem Sentiment und militanter Harmoniesucht, einmal aber auch aus deutscher Leitkulturhaftigkeit. Weihnachtsmärkte sind Bollwerke deutscher Leitkultur, drumherum fluten Merkels Asylanten, die Weihnachten abschaffen und die Engel mit Kopftüchern versehen wollen. Herr Kainer grinste dazu reichlich voltairisch.
In solcherlei Betrachtungen vertieft, schlenderten – nein, kein Schlendern war’s, sondern ein Geschoben- und Gedrängtwerden – die drei Freunde über den Markt. Dann hörten sie eine Stimme: „Na, det sin ja lustige Heilige Drei Könige, die ham ’nen authentischen Mohren, wa!“ Selbst der Rassismus kommt hier natürlich in weihnachtlichem Gewand.
Was um Himmels willen machen wir hier?, fragte sich nun Herr Reiner und blickte verstohlen um sich: Auf einer Bühne stehen arme Schulkinder und singen falsch, doppelt falsch, nämlich einerseits, indem sie beharrlich die richtigen Töne nicht treffen, zum anderen aber, indem sie das übliche weihnachtliche Liedgut in Arrangements vortragen, die eines Dieter Bohlen in seinen schlimmsten Tagen würdig wären (ich will damit nicht behaupten, er hätte je andere gehabt, Tage, meine ich, fügte Herr Reiner an). Schlimm wird das allerdings erst durch die krächzenden Verstärker, die dieses „Deutschland sucht den grausamsten Weihnachtssound“ in alle Ecken des, nun, jawohl: Weihnachtsmarktes übertragen, als fürchte man sich vor jedem Augenblick der Stille. Eine andere Flucht als zu den Glühweinständen ist unmöglich.
Jede deutsche Gemeinde hat einen Weihnachtsmarkt. Ein kurzer Feldversuch bringt zutage, dass ein gutes Drittel aller Besucher gekommen sind, um über das Ziel ihres frühabendlichen Ausflugs zu lästern. Und dabei handelt es sich nicht nur um Kids, die nach dem dritten Zuckerschock ihren Freunden smartphonen: Hey, Alter, ist euer Weihnachtsmarkt auch so abgefackt?
Die Klassen bleiben unter sich
Ist es wieder einmal die „Elite“, fragte sich derweil Herr Rainer (mit einem besorgten Seitenblick auf Herrn N’Bembé, der freilich von ihnen dreien bester Dinge schien), die über das volkstümliche Vergnügen, das warme Wir-Gefühl herzieht? Mitnichten! Die Elite, man erkennt sie an ihren Kleidern, ihren Hunden, hat eigene Glühweinstände oder doch Areale vor ihnen besetzt, die durch Protz und Gekicher gegen das gemeine Volk verteidigt werden. Auf einem deutschen Weihnachtsmarkt ist zwar das Deutsche und das Weihnachtliche umfassend versöhnt, die Klassen sind es nicht.
Und ich tippe einmal, entfuhr es dem Weihnachtsmarkt-Lästerer, dass all dieser Budenzauber nur ein Anlass ist für das allgemeine, aber doch sozial streng strukturierte Besäufnis. Wahrscheinlich wäre dies die genaueste Definition von deutscher Leitkultur: Die Inszenierung der Anlässe für die ständisch-hierarchisch organisierten Besäufnisse. Das deutsche Volk geht nicht einfach in eine Kneipe, um sich mit Kumpelinnen und Kumpeln zu besaufen, es braucht einen kulturellen Anlass. Einen Bierzelt-Wahlkampf, das Oktoberfest, den Karneval, Silvester oder eben, seit Neuestem, den Weihnachtsmarkt. Der Besäufnisvorwand entschädigt für die Inflation des Warenangebots und die Deflation der Erwartungen.
Freilich hat es Weihnachtsmärkte schon immer gegeben. Und manche hatten vielleicht etwas vom Glanz einer Ludwig-Richter-Radierung, einen Duft, eine Einzigartigkeit. Als ein Massenphänomen der deutschen Leitkultur (Ideologie plus Ökonomie plus Besäufnis) ist der Weihnachtsmarkt verhältnismäßig neu. Er verspricht nicht mehr viel, er muss einfach sein. Er erzeugt die Illusion einer lokalen Wirtschaft und vormoderner Produktionsweisen; Kapitalismus ist hier mittelalterlich verkleidet. Und es ist einer der Hotspots, wo Deutsche sich in ein „Volk“ verwandeln wollen. Herr N’Bembé wunderte sich über den Spott seiner Freunde über die eigene Kultur, aber er verstand auch: Sollte jemand „Die letzten Tage der Menschheit“ des Karl Kraus auf gegenwärtige Verhältnisse übertragen, der deutsche Weihnachtsmarkt würde eine ideale Bühne abgeben.
Die Sehnsucht nach Geborgenheit
Herr Reiner hatte unterdessen drei „Pötte“ Glühwein erstanden. Er nahm einen Schluck und gestand: Das Zeug schmeckt abscheulich. Eine Beleidigung für jeden Menschen, der schon einmal einen Rebstock in all seiner kraftvollen Poesie gesehen hat. Aber dann konnte er nicht umhin, zu bemerken, wie eine sonderbare Wärme durch Körper, Geist und Seele nebelte. Oh, wie schnell Herr Reiner verstand, welche Sehnsüchte sich hier kreuzten. Die Sehnsucht nach Identität, nach Geborgenheit, nach einem Glück, das sich immer hartnäckiger zu entziehen scheint.
Als der zweite Pott Glühwein vor ihm stand, wusste Herr Reiner, das er selber Teil eines deutschen Weihnachtsmarktes geworden war. Er entsann sich früherer Weihnachtsfeste, des Duftes von Kerzen und der vom Vater mit heiligem Ernst vorgetragenen Geschichte. Ein Gebot sei da ausgegangen, von einem gewissen Kaiser Augustus, dass ein jeder sich schätzen lassen solle, und dann gab’s für Josef und seine Frau, die war schwanger, keinen Raum in der Herberge. Am Ende aber, und damit wurde die Bibel zugeklappt: „Und Friede auf Erden“.
Und dann bemerkte Herr Reiner, dass er sich dessen nicht nur entsonnen hatte, sondern es auch mit lauter Stimme vorgetragen, nicht nur seinen Freunden, dem Herrn Kainer und dem Herrn N’Bembé, sondern auch einer Dame, die sich nichts draus machte, Gucci und C&A-Tüten zu kombinieren, und verständnisinnig lächelte. Und als irgendjemand lautstark „Früher war mehr Lametta“ rief, da lachte auch Herr Reiner mit den anderen, und er hörte sich lachen und sehnte sich . . . ja, wonach? Er hörte noch Herrn N’Bembé „Sehr interessant“ sagen, dann war er in den Labyrinthen deutscher Vorweihnachtlichkeit verschwunden.

In Berlin baut ein gelernter Schweißer den größten Hindu-Tempel Deutschlands – seit mehr als neun Jahren. Große Erwartungen treiben uns an. Sie finden sich in jedem Leben, besonders in der Weihnachtszeit. Die taz.am wochenende vom 24./25./26. Dezember widmet sich ihnen. Mit dabei: eine Kunstschätzerin, ein Pfarrer und ein Alleinunterhalter, die über den professionellen Umgang mit Erwartungen reden. Und: der magische Moment, bevor das Überraschungsei ausgepackt wird. Am Kiosk, eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo.
Und damit könnte unsere Weihnachtsgeschichte enden. Mit einem Brummschädel, einer Selbsterkenntnis, einer nicht recht reflektierten Versöhnung und einem schwer gescheiterten Versuch der Binnenethnologie.
Aber mit einem Schlag war alles anders.
Aus einer vagen Gefährdungsangst war blutige Wirklichkeit geworden. Getötete Menschen, verwundete, blutende. Schmerzen und Leiden. Die Erfahrung von Ohnmacht und Sinnlosigkeit gegenüber etwas, das man augenblicklich nur als das Böse begreifen kann. Ein Trümmerfeld und eine mediale Giftwolke. Und im Anschluss daran: die Unfähigkeit zu trauern. Dass die üblichen Verdächtigen von rechts sofort zur propagandistischen Leichenfledderei übergehen, war zu erwarten, und auch von Horst Seehofer hat niemand auf dieser Welt mehr politische Anständigkeit erwartet.
Der Wahnsinn der Welt
Und doch, wie pflegte Herr Kainer zu sagen?: Eine Gesellschaft erkennt man darin, wie sie mit ihren Verlusten und Opfern, ihrem Tribut an den Wahnsinn der Welt umgeht. Hatte ein „9/11-effect“, ein „Je suis Charlie“, eine Kraft, die nicht aus dem Hass, sondern aus der gemeinsamen Trauer stammt, eine Chance? Aber der Hass richtete sich ja gar nicht auf den Attentäter zuerst, er wurde vor allem gegen die eigene Gesellschaft und ihre demokratischen Repräsentanten laut. Die Volksverräter, die keine Grenzen dicht machen, keine Obergrenzen wollen, die irgendwas von uns zu „schaffen“ verlangen, was wir nicht schaffen wollen.
Es war, als hätte das Attentat dann eben doch nicht nur dazu gedient, möglichst viele Menschen zu töten und leiden zu lassen, wie es der grausamen Logik des Terrors entspricht, sondern auch diesen „Geist von Weihnachten“, der in jeder Weihnachtsgeschichte schon abhandengekommen zu sein scheint, um dann doch überraschenderweise und sei’s, wie in unserem Fall, in ironischer Brechung wieder aufzuscheinen.
Denn wie das alles auch war, mit dem Augustus, der Herberge, dem Stall, den Hirten, Engeln und Königen, was geblieben war, von dem, was uns in den Weihnachtsgeschichten in die prekären Kindheiten schien, das war das Licht, das eine bessere Zeit verheißen würde: Und Friede auf Erden. Der unverschämteste, tückischste und anstrengendste Satz, zu dem unsere Kultur in der Lage war. Friede auf Erden, verstehen Sie, sagte Herr Reiner nicht ohne Verzweiflung zum Herrn N’Bembé, nicht im Himmel, nicht jenseits von Mord und Totschlag, nicht als Belohnung für ach so heilige Kriege. Sondern hier und jetzt. Das ganze semantische Brimborium, der narrative und ikonografische Aufwand, der Rummel, das Besäufnis, die furchtbare Musik. Es dient nur einem Zweck: diesen einen Augenblick zu erzeugen. Friede auf Erden. Und sei der Augenblick auch noch so kurz. Ich weiß, lächelte Herr N’Bembé gütig, und all das dient zugleich zum Zweck, ihn zu verhindern.
Das weiche Ziel des Terrors
Hatte der Attentäter sein Ziel mit Bedacht gewählt? Wäre die Inszenierung des deutschen Weihnachtsmarktes dann so sehr „Einladung“ für den Terroristen, wie die Herstellung von Mohammed-Karikaturen die Kalaschnikow- und Messer-Reaktion provozierten? Natürlich nicht. Es handelt sich eher um eines jener weichen Ziele des Terrors, deren hundertprozentige Sicherung nie anders als um den Preis der Selbsterstickung möglich ist. Anderswo trifft es Basare und sogar Moscheen.
Ein Terrorist ist kein Mensch, der sich einer großen Idee verschreibt und in ihrem Namen Mordtaten zu begehen bereit ist. Ein Terrorist ist ein Mensch, der sich für seine Mordlust eine große Idee sucht. Das ist seine Aussage: Kein Friede auf Erden. Wie kommt das, fragte Herr N’Bembé, in eurer Weihnachtsgeschichte vor?
Gar nicht, mussten Herr Reiner und Herr Kainer zugeben. Sie wussten, dass sie gerade die letzte aller möglichen Weihnachtsgeschichten erzählt hatten.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









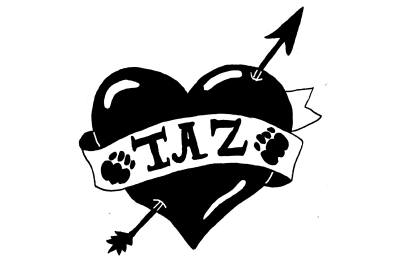
meistkommentiert
Ole Nymoen und die Frage des Krieges
Kampflos in die Unfreiheit?
Juristin über Ja-heißt-Ja-Reglung
„Passives Verhalten bedeutet nicht sexuelle Verfügbarkeit“
Juryauswahl bei Harvey-Weinstein-Prozess
Nicht objektiv genug
Politologe über Brandmauer und CDU
„Wenn die CDU jetzt klein beigibt, ist sie bald überflüssig“
Ewigkeitschemikalien
Versicherer mutiger als der Staat
Produkte aus den USA meiden
Ohne Cola und Country-Musik