Ein Original vom Kotti: „Ich kenne das auch vom Kampfsport“
Raplabel-Chef, Journalist, Aktivist, Kampfsportler, Fensterputzer und Industriekletterer: Marcus Staiger über sein Leben in einem krassen Interview.
Wir treffen uns am Kotti. Fürs Interview muss Marcus Staiger vor dem Sozialpalast über der Adalbertstraße das Fotomodell geben. Er ist sich nicht zu schade, einen Handstand vorzuführen. Währenddessen kommt zufällig ein Bekannter vorbei und fragt, wie es ihm gehe. Alles gut! Und bei dir? Wir setzen uns in der noch warmen Oktober-Sonne vor die Bäckerei Simitdchi, trinken Çai. Dreimal im anderthalbstündigen Gespräch kommen Leute vorbei, smalltalken mit Staiger und fragen, wie es ihm geht. Alles gut! Und dir?
taz: Herr Staiger, hier am Kotti kommen Sie offenbar keine fünf Meter weit, ohne erkannt zu werden, oder?
Marcus Staiger: Doch, doch.
… aber irgendwie sind Sie schon ein Original vom Kotti. Sie standen schon vor 16 Jahren da drüben auf einem Mülleimer und haben vor den Junkies eine Promo-Rede für Ihr Raplabel Royal Bunker gehalten.
Der Mensch Staiger ist 49 Jahre alt, kam nach seinem Abitur in Kornwestheim 1992 nach Berlin, jobbte zunächst unter anderem als Koch. Ab 1993 studierte er Philosophie und VWL. 2000 gründete er das HipHop-Independent-Label Royalbunker, das bundesweit als Talentschmiede für Berliner Rapper bekannt wurde und Künstler wie Kool Savas, KIZ, MOR, Prinz Pi, Die Sekte und Eko Fresh hervorbrachte. Benannt war es nach den von Staiger organisierten legendären Open-Mic-Sessions im Keller der Kreuzberger Kneipe „Royalbunker“ in der Mittenwalder Straße, die so etwas wie die Ursuppe des Berliner Battle-Rap wurde. Nachdem er 2008 das Label Royalbunker geschlossen hatte, machte Staiger in HipHop-Journalismus und war bis 2011 Chefredakteur der Internetplattform rap.de, wobei er häufig vor allem bei Rappern durch Kritik und Interviews aneckte. Danach war er als freier Journalist tätig. Mittlerweile ist er Aktivist und arbeitet als Industriekletterer, hat aber auch noch den wöchentlichen Rap- und Politik-Podcast „Die wundersame Rapwoche“, in dem er zusammen mit dem Musiker Mauli die Rap-Bubble radikalisiert. Zudem betreibt er das linke Youtube-Magazin Kommon und den Bunkertalk. Staiger engagiert sich in antirassistischen Initiativen und beim Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. In seiner Freizeit macht er Brazilian Jiu-Jitsu und studiert Politik an der Fernuni Hagen. Staiger ist verheiratet und hat mehrere Kinder. (gjo)
Ja, trotzdem erkennen mich hier nicht gleich alle. Hier gibt es ja Leute, die wirklich in Gangs waren und hier ihr Leben lang gewohnt haben. Ich wohne erst seit zehn Jahren in der direkten Umgebung. Mein Büro hatte ich früher in der Falckensteinstraße im Wrangelkiez. Aber bei diesen ganzen Gang-Geschichten – 36 Boys und wie sie alle hießen – war ich immer eher Gast.
Als Labelchef in den nuller Jahren und als Host der legendären Open-Mic-Session in der ehemaligen Kneipe Royalbunker waren Sie ein halber Sozialarbeiter, haben Sie mal gesagt. Kannten Sie deswegen die ganzen Jungs aus den Gangs?
Ich kenne Einzelne, die dabei waren.
Berlins damals bekanntesten Rapper Kool Savas etwa.
Ja, Savas war in einer Gang. Aber auch ein ehemaliger Boxtrainer von mir war mal bei den 36 Boys und hatte hier um die Ecke einen Laden.
Als Sie später Chefredakteur von rap.de waren, wurden Sie nach einer negativen Albumrezension vom Rapper Blokkmonsta niedergeschlagen, ebenso haben Sie bis heute als linker Aktivist häufig Stress mit Polizisten. Wer wollte Sie häufiger verprügeln: Nazis, Polizisten oder Rapper?
Rapper, glaube ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich bei Nazis auf dem Schirm bin. Und bei Polizisten habe ich oft den Eindruck, es gibt eine Hassliebe. Viele sind Rapfans und enttäuscht, dass ich auf der anderen Seite stehe. Aber gegen die Polizei ist es kein fairer Kampf: Die wollen sich prügeln und dich danach vor Gericht zerren. Und wenn sie dich mal in den Klauen haben, ist meine Erfahrung, dass sie häufig dir persönlich wehtun wollen. Bei der Luxemburg-Liebknecht-Demo wurde ich mal festgenommen. Die haben mich zu Boden gebracht, sind auf mir gekniet und dann: Gib ihm … Auf der anderen Seite denke ich, ja gut, das gehört zum Spiel dazu. Finde ich auch nicht sonderlich schlimm, weil ich körperliche Auseinandersetzungen durch Kampfsport gewohnt bin.
Haben Sie wegen der Rapper, die sich nach kritischen Kommentaren prügeln wollten, oder wegen der Polizei mit Kampfsport angefangen?
Ich wurde in der Schulzeit in Kornwestheim in der Nähe von Ludwigsburg viel verprügelt. Ich war richtig frech und deswegen gab es immer ein paar Trottel, die mich scheiße fanden. Das war manchmal wie ein Spießrutenlauf, weil ich den anderen richtig wehjntun konnte mit Worten.
War das auch ein Grund, warum Sie nach Berlin gegangen sind? Auf der Flucht aus der schwäbischen Provinz und vor der Enge der Familie?
Es gab große Zerwürfnisse. Ich bin wirklich sehr kleinbürgerlich aufgewachsen. Mein Vater war Gipser und Berufsfeuerwehrmann und meine Mutter Schreib- und Bürokraft. Aber das war nicht der Grund, warum ich gegangen bin. Es war eher die Suche nach einer Herausforderung. Ich wollte probieren, woanders Fuß zu fassen. Das Verhältnis zu meinen Eltern hat sich durch meine späte Politisierung noch einmal verändert. Ich sehe sie jetzt eher klassenanalytisch, sie kommen halt nicht raus aus ihrer Rolle, was mir natürlich leidtut.
Sie zitieren in Ihren Rap-Podcast- und linken Youtube-Formaten immer wieder Marx. Wie kam Ihre Politisierung zustande?
Ich war schon Schülersprecher und habe mich immer als politischer Mensch verstanden. Royal Bunker war auch irgendwo ein politisches Projekt – auch wenn es nie richtig ausformuliert war. Nach meinem Philospophie- und VWL-Studium in den Neunzigern habe ich mich vor allem um 2013 herum politisiert. Das Flüchtlingscamp auf dem Oranienplatz hat mich nicht losgelassen. Da habe ich eine Reportage gemacht und hatte irgendwie den Eindruck, es läuft gesellschaftlich alles nicht mehr so rund.
Was haben Sie dann gemacht?
Ich dachte: Man muss wieder theoretisch in Auseinandersetzungen gehen. Ich habe angefangen, wieder wirklich schweres marxistisches Textmaterial zu lesen, und bin immer wieder bei Texten vom Verlag Gegenstandpunkt gelandet. Dadurch habe ich mich radikalisiert, aber nicht wegen des Gestus, sondern weil man es radikal ändern muss. Die Grundpfeiler der Produktionsweise sind nicht verbesserbar. Sie sind gefährlich, unvernünftig, schlecht und müssen abgeschafft werden.
Wie sieht Ihre gesellschaftliche Utopie aus?
Echte Freiheit gibt es nur im Kollektiv. Wenn wir alleine sind, sind wir den Kräften dieser Marktwirtschaft frei ausgeliefert, Zwängen unterworfen und machen am Ende alle das Gleiche. Nur, wenn wir uns gemeinsam organisieren, schaffen wir es, so viel Freiräume zu schaffen, dass wir uns entfalten können.
Was hat Marx mit Ihrem Blick auf die Polizei gemacht?
Die Polizei ist für mich das, was Marx mit Lumpenproletariat beschrieben hat. Das sind so Leute, die entweder Gangster, Polizisten oder Securitykräfte werden. Die Wege dahin sind offen aus dem Subproletariat. Ich kenne das auch vom Kampfsport. Dort treffen sich immer dieselben Typen: Das sind Polizisten, ehemalige Soldaten, Sicherheitskräfte, Fremdenlegionäre, Abenteurer, Türsteher, Antifas. Die Antifa-Türsteher sind ja nicht grundverschieden von den Polizisten oder arabischen Gangstern, die da rumhängen. Irgendwie ist das so ein bestimmter Schlag Mensch. Ich spüre selbst mit Polizisten manchmal Klassensolidarität.
Echt?
Ich war mal bei Gericht. Da haben der Richter und der Staatsanwalt den Polizisten angeschnauzt und rundgemacht. Da wäre ich am liebsten eingeschritten: Warum schnauzen diese studierten Leute den armen Typen an, der nur seinen Job gemacht hat? Ich würde mir manchmal wünschen, Polizisten würden ihre Klassensituation erkennen und sagen: Ey, was wir hier machen, ist totaler Quark. Wir schützen hier die Reichen und halten den Kopf hin für die ganze Scheiße. Aber das kriegen die als Ordnungsfanatiker und Rechtspositivisten natürlich nicht hin. Was mich aber immer wundert, ist, dass sie alles so persönlich nehmen.
Inwiefern?
Ich sehe die Verhältnisse eher abstrakt: Wir gegen die und die Polizei steht auf der anderen Seite. Aber die reagieren mit: Ey, du hast mich beleidigt – das vergesse ich dir nie, der Staiger geht uns richtig auf den Keks. Ich frage mich, was deren Lebensinhalt ist. Gegen den einzelnen Menschen habe ich nichts und ich schreibe nirgendwo ACAB (All Cops Are Bastards – Anm. d. Red.) hin, aber denke mir schon: Diese Leute haben sich für diesen Beruf entschieden und könnten sich in ihrem Beruf anders verhalten. Tun sie aber nicht. Also sind sie eigentlich schon auch scheiße, sorry.
Sie engagieren sich derzeit auch beim Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co enteignen. Mietenpolitik ist seit Jahren das Mobilisierungsthema Nummer eins für die Linke. Was bedeutet die Wohnfrage heute?
Für mich sind Mieten und Stadtpolitik Teil eines Themas, das über allem steht: Demokratisierung von Gesellschaft. Wir sollten demokratisch über die wirtschaftliche Produktionsweise entscheiden, ebenso wie wir uns überlegen müssen, wie wir Wohnraum und Eigentum gestalten. Inwiefern ist Wohnen Teil des wirtschaftlichen Produktionsprozesses und wie ändern wir das? Wohnraum ist die Brotfrage des 21. Jahrhunderts. Bewegungen aufzubauen, die das Potenzial haben, revolutionäre Fragen zu stellen – das macht das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co enteignen. Und zwar in einer Breite, die auch Wirkung hat.
Was lässt sich heute nicht mehr mit Marx erklären?
Die kapitalistische Verwertung von geistigem Eigentum. Es ist ein anderer Prozess, eine Software zu schreiben, die millionenfach verkauft wird, als Autos zu erfinden und zu bauen. Da muss man die marxsche Analyse weiter denken. Aber auch das ist in seiner Theorie als die große Wissensmaschine schon angelegt: Wie sieht die Welt aus, wenn in den Produkten nicht mehr so viel händische und materielle Arbeit steckt, sondern Wissen? Insofern sind Software und Paywalls eher feudalistisch, weil du Grenzen errichtest und Wegezoll verlangst. Sie sind anders als die kapitalistische Produktionsweise.
Sollte man Google, Amazon und Facebook zerschlagen?
Man muss sie enteignen und demokratisieren. Die bauen ja durchaus interessante und nützliche Sachen. Es ist aber ein Riesenproblem, wenn das alles in Privatbesitz ist. Ähnliches gibt es bei der Corona-Entwicklung: Die Mischung aus Gesundheitsindustrie und Überwachung – dass vieles davon in privater Hand ist, ist problematisch.
Wie schätzen Sie das revolutionäre Potential von Rap ein?
Rapper sind keine politischen Subjekte. Ich war früher hoffnungsvoller, aber auch hier greift Marx’ Lumpenproletariat: Viele Rapper ergreifen holterdiepolter die Chance, selbst bourgeois zu werden.
Also die klassische Aufstiegserzählung von der Straße ins Villenviertel.
Das ist das, was ich leider beim Rap beobachten kann. Es sind Leute, die durchaus aus prekären Situationen starten, aber ihre Klasse verraten und auf die andere Seite wechseln. Rap ist Klassenkampf ohne Klassenbewusstsein. Deshalb würde ich auf Rapper nicht unbedingt zählen. Es gibt natürlich auch gute Ansätze und es wird sich auch verbessern. Je politischer die Gesellschaft wird, desto politischer wird Musik wieder. Rap ist eben auch nur der Soundtrack zur Gesellschaft.
Sie versuchen mit Ihrem Podcast, diesen Prozess zu begleiten. Dort gibt es häufig szeneinterne, antirassistische und antisexistische Kritik. Werden Sie es schaffen, die Rapbubble zu radikalisieren?
Ich glaube nicht, dass Rap eine pädagogische Aufgabe hat und Leute erziehen soll. Mich freut aber, wenn gesellschaftliche Themen in die Rapcommunity reinschwappen. Dennoch werden Leute von außen politisiert. Das war bei KIZ auch so: Die sind nicht durch Rap politisch geworden, sondern haben irgendwann angefangen, sich politisch zu interessieren, auf verschiedene Veranstaltungen zu gehen und Texte zu lesen. Das spiegelt sich in ihrer Musik wider.
Wie traurig sind Sie, dass Gangsta-Rapper Fler, mit dem Sie in Ihrem kontroversen Talk-Format „Bunker-Talk“ gesprochen haben, sich jetzt beim erklärten Feind und Corona-Querfront-Guru Ken Jebsen von Ken FM politisiert hat?
Sehr, sehr traurig, weil er dort gesagt hat, dass Ken Jebsen ihn politisiert hat und nicht ich. Da bin ich in meiner Eitelkeit gekränkt. Klar könnte ich meine Gesellschaftsanalyse einfacher machen, damit sie anschlussfähig ist. Aber das macht keinen Spaß und so funktioniert es auch nicht. Wenn ich aber eine Gesellschaftsanalyse anbiete wie Ken Jebsen, wo immer gewisse Kreise schuld sind, die auch noch moralisch verdorben sind, passt Rap da ganz gut rein.
Ja, stimmt, das klingt eigentlich wie jeder dritte Kollegah-Track.
Mit einem Kumpel zusammen hatten wir neulich folgende These: In einer Gesellschaft wie unserer, in der Money-Culture eine große Rolle spielt, ist es verpönt, Reiche anzugreifen. Man führt in Deutschland ja auch keine Neid-Debatte – man möchte ja selber reich sein. Trotzdem merken die, dass nicht alles so geil läuft in dieser Gesellschaft, und deshalb fangen sie an, die Reichen moralisch zu kritisieren. Und dafür taugt das Bild des satanistischen Kinderschänders am besten – also, wenn man die Elite als moralisch verdorben darstellt. Wobei man sich die Option offenhält, selbst zur Elite zu gehören, aber dann natürlich alles besser zu machen. Die Kritik lautet nicht: Das ist ein Ausbeutersystem, hier sind die Ausbeuter. Sondern: Das System ist in Ordnung, aber die, die am Drücker sind, sind die Teufel und die Bösen.
Ein weiteres Problemfeld im Hiphop sind Männlichkeitsdiskurse. Können Sie als jahrzehntelanger Begleiter des Szene sagen, was spezifisch ist für Sexismus im Rap?
Im Rap ist es ein besonders heißes Thema. Bei Rassismus sind sehr viele Leute aus der Community sehr wachsam. Aber die Schlampen wegboxen ist oft kein Ding. Bei Antifeminismus und Homophobie stimmen komischerweise Gruppen überein, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben: Nazis, Hooligans und patriarchale Migranten können an diesem Punkt sehr gut miteinander. Sexismus ist ein Gift, das man wie Rassismus bekämpfen muss.
Sexismus war aber für die Rapper Gzuz und Bonez aber zuletzt nicht unbedingt karriereförderlich, oder?
Es hat ihnen aber auch nicht übertrieben geschadet. Wenn sie das N-Wort gesagt hätten, wäre ganz anderer Alarm gewesen. Dann hätten die ganz schnell klein beigeben müssen.
Frauen sind in der Szene unterrepräsentiert. Gefühlt hat sich die Situation in den vergangenen Jahren durch neue Künstlerinnen allerdings etwas verbessert, oder?
Also, zumindest gibt es nicht mehr diese ganz bescheuerte Diskussion von wegen: Frauen haben im Rap nichts zu suchen. So etwas sagen wirklich nur noch so hängen gebliebene Mittvierziger. Häufig heißt es trotzdem, es gibt ja kaum Rapperinnen. Aber das stimmt einfach nicht. Wenn du dich aktiv bemühst, dann findest du die auch. Trotzdem haben Frauen in der Musik- und Unterhaltungsindustrie nach wie vor große Probleme. Wie ihr Image designt wird. Wie sie als Künstlerinnen ganz anders bewertet werden als Männer.
Besonders deutlich wird die allgegenwärtige Mysogynie in sozialen Medien. Müsste man vor allem anderen nicht zuerst mal das Patriarchat zerstören?
Klar würde ich mir das wünschen, aber es ist leider sehr langlebig. In der kurdischen Bewegung gilt es sogar als das zentrale Unterdrückungsverhältnis, aus dem sich alle anderen abgeleitet haben. Feudalismus, Sklaverei, Rassismus, Kapitalismus sind alles Produkte des Patriarchats.
Im Frühjahr starten Sie und Mohamed Chahrour bei Radio Fritz einen wöchentlichen Podcast über arabische Clans. Worum wird es da gehen?
Es ist wie ein True-Crime-Podcast mit viel Recherche. Wir haben viele Interviews mit Protagonisten aus arabischen Großfamilien gemacht. Es wird der Gegenentwurf zu den Erzählungen etwa von der B. Z. über „die Clans“. Wir schauen auf Herkunft und Ankunft in Deutschland. Wie gestaltet sich das Leben der Leute, die stigmatisiert werden und keinen Aufenthalt bekommen, die von Amt zu Amt rennen und jedes Mal damit rechnen müssen, abgeschoben zu werden? Wir betrachten differenziert Verbindungen zwischen Musik und organisierter Kriminalität. Aber es gibt natürlich auch das große Interview mit Arafat Abou-Chaker.
Oh, und wie war das?
Das Weltbild von solchen Leuten ist wahrscheinlich so ähnlich wie das von großen Wirtschaftskapitänen oder einem CEO. Du weißt genau, die machen Raubbau in Afrika und verschmutzen die Meere. Aber sie erzählen dir von ihren sozialen Projekten.
Was sagt der Großfamilien-Patriarch?
Der sagt: Es war nicht immer alles gut, was ich gemacht habe. Aber ich habe mich immer bemüht, ein guter Mensch zu sein. Und in seinem Universum ist das wohl auch so.
Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten: Labelchef, Journalist, Kampfsportler, Politaktivist. Zudem arbeiten Sie als Industriekletterer und putzen Fensterfassaden. Wie ist es mit Politik auf der Maloche?
Da gibt es immer ein Abtasten. Die Grenze ist häufig bei Flüchtlingspolitik und Rassismus. Da gibt es häufig sachte Bemerkungen, und dann weiß man schon: Okay, der tickt offenbar so. Ich versuche aber schon immer, Themen auf eine klassenkämpferische Perspektive zu drehen. Ich mache zum Beispiel Unterweisungen im Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz. Ich sage immer: Arbeitsschutz ist Pflicht des Arbeitgebers und den müsst ihr einfordern. Die Kollegen sagen, in der Praxis und unter Zeitdruck sieht das ganz anders aus, und fühlen sich ihrem Arbeitgeber mit einer regelrechten Nibelungentreue verpflichtet. Im Endeffekt ist es schon Arbeitskampf, wenn du sagst: „Ey, pass auf, wenn du unten in der Grube stirbst, weil kein Abstützmaterial da war, bist du am Ende tot und für deine Arbeit gestorben.“
Und so bekommen Sie die?
Na ja, man kriegt die nicht unbedingt. Viele sind auch stolz darauf, ein besonders harter Hund zu sein und mit Fieber arbeiten zu gehen. Witze funktionieren häufig besser. Damit kriegt man die Jungs auf der Baustelle ganz gut.
Erzählen Sie mal einen!
Okay: Der Chef kommt auf den Hof gefahren mit einem neuen Lamborghini. Kommt der angestellte Arbeiter heraus und sagt: „Boah, geiles Auto!“ Sagt der Chef: „Ja. Und wenn du dich selbst richtig reinhängst, richtig knüppelst und Überstunden schuftest – dann habe ich nächstes Jahr einen zweiten.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







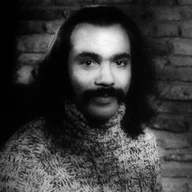

meistkommentiert