Die DDR ein Unrechtsstaat?: Streit um Deutungshoheit
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow wollen die DDR nicht Unrechtsstaat nennen.
Als sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag dafür aussprach, die DDR nicht als „Unrechtsstaat“ zu bezeichnen, klang das in vielen Ohren nach: „Es war ja nicht alles schlecht.“ Die Widerrede kam prompt, unter anderem von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Roland Jahn an, Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, der in der DDR selbst als Oppositioneller in Haft saß.
Nun ist es nicht so, dass Schwesig den SED-Staat verharmlost hat. Im Wortlaut sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Die DDR war eine Diktatur. Es fehlte alles, was eine Demokratie ausmacht: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, freie Wahlen, das Recht auf Opposition.“ Die Diktatur als gewaltsame Herrschaft der Wenigen erscheint ihr sprachlich angemessener als der Begriff „Unrechtsstaat“. Obwohl der darauf abzielt, die Staatsform der DDR als ungerecht zu charakterisieren, nicht etwa Individuen, fühlten sich gemäß Schwesigs Logik viele ehemalige DDR-BürgerInnen durch ihn herabgesetzt, sprachlich unsichtbar gemacht in ihrer Lebensleistung – und Rechtschaffenheit.
Vor allem in Abgrenzung zum „Rechtsstaat“ auf der anderen Seite Deutschlands, in dem ja nun bekanntlich auch nicht alles mit „rechten Dingen“ zuging. Schwesigs Thüringer Kollege Bodo Ramelow (Linke) führte noch ein anderes Argument ins Feld: Für ihn sei der Begriff „mit der Zeit der Naziherrschaft und dem mutigen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und seiner Verwendung des Rechtsbegriffs ,Unrechtsstaat' in den Auschwitz-Prozessen verbunden“.
Thema für Historikerinnen
Wie man den ehemaligen SED-Staat nun nennen soll, ist in erster Linie ein Thema für Historikerinnen und Demokratietheoretiker. Spannend ist vor allem die Frage, warum nur alle so scharf darauf sind, die DDR einen „Unrechtsstaat“ nennen zu dürfen.
Woher kommt die Obsession mit dem Begriff, wenn die „Diktatur“ (die, das wird Bodo Ramelow einwenden müssen, durchaus auch die Zeit von 1933 bis 1945 bezeichnet) es ebenso tun würde? Woher kommt die semantische Sensibilität in einem Land, in dem man sich um geschichtsbewusstes Vokabular an anderer Stelle so wenig schert, dass Zeitungen immer noch dann und wann die Pogromnacht zur „Reichskristallnacht“ aufhübschen?
Der Kampf um den Begriff ist ein Streit um Deutungshoheit, in dem sich Defizite bei der Aufarbeitung des DDR-Erbes zeigen – auf Ost- wie auf Westseite. Denn einerseits ist es verständlich, dass sich Ostdeutsche nicht zum dutzendsten Mal erklären lassen mögen, wie frei oder unfrei ihr Leben in der DDR ablief. Andererseits darf man sich schon fragen, ob Debatten um die politische Organisation eines Staats, der vieles war, aber keine „demokratische Republik“, wirklich der richtige Ort sind, um über persönliche Abwertungserfahrungen nachzudenken.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





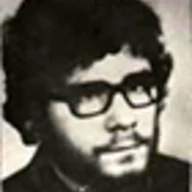
meistkommentiert