Deutschlands Wehrhaftigkeit: Wehrpflicht versus Berufsarmee
Die Bundeswehr kann ihr modernes Equipment finanzieren. Lösungen für das Personalproblem stehen indes aus und sind umstritten.

G eld ist genug da. Nachdem der alte Bundestag schnell noch beschlossen hat, die Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit weitgehend von der Schuldenbremse auszunehmen, sind die finanziellen Hürden gegen eine massive Aufrüstung abgeräumt. Was fehlt, sind Soldaten. Circa 182.000 stehen zurzeit unter Waffen, und die Bundeswehr hat mit Schwund zu kämpfen. Dabei wären mehr als 200.000 nötig, und der Bedarf wird noch wachsen. Doch woher nehmen?
Zu Zeiten des Kalten Kriegs war es einfach. Die Wehrpflicht – in der Bundesrepublik 1956 eingeführt, in der DDR 1962 – verschaffte beiden Armeen einen stetigen Zufluss junger Männer. Auf 170.000 Mann wuchs die NVA, auf 500.000 kam die Bundeswehr. Dass ab dem Ende der Blockkonfrontation 1990 die Zahl kontinuierlich sank, durfte als Friedensdividende gebucht werden. Allein der Wehrgerechtigkeit wegen war es geboten, die Wehrpflicht 2011 auszusetzen.
Der ewige Frieden ist vorbei – eigentlich schon seit der Annexion der Krim und dem Beginn des Kriegs im Donbass, spätestens aber seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Nach drei Jahren Krieg hat Putin seine Kriegsziele zwar nicht erreicht, wähnt sich aber, auch weil Trump ihm entgegenkommt, auf der Siegerstraße. Und es soll nicht bei der Ukraine bleiben, davon gehen zumindest westliche Geheimdienste aus. Ab 2029 wird Russland vermutlich in der Lage sein, Angriffe auf Nato-Staaten, etwa die baltischen Nachbarn, zu wagen.
Allein schon um möglichen Nato-Verpflichtungen nachkommen zu können, muss Deutschland also kriegstüchtig werden. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte das Wort bewusst gewählt: Es bedeutet, dass wir in der Lage sein sollen, einen militärischen Angriff abzuwehren. Um auf die notwendige Truppenstärke zu kommen, werden verschiedene Modelle diskutiert.
Den Dienst an der Waffe attraktiver machen
Da ist zum einen die Wehrpflicht. Vom damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg 2011 nicht abgeschafft, sondern lediglich ausgesetzt, kann sie mit einfacher Bundestagsmehrheit wieder eingesetzt werden. Das würde auf einen Schlag viele junge Männer – für Frauen gilt sie nicht – mobilisieren, für die es jedoch weder ausreichend Musterungsbehörden noch Kasernen und Ausbilder gibt, von Ausrüstung nicht zu reden.
Kann aber nur ein kleiner Teil gemustert und eingezogen werden, drängt sich sofort wieder die Gerechtigkeitsfrage auf. Warum muss ich zum Bund und mein Nachbar nicht? Um dieses Dilemma zu umschiffen, bietet sich ein Freiwilligenmodell an. Der „Neue Wehrdienst“, ein Vorschlag des Sozialdemokraten Pistorius, basiert auf Freiwilligkeit: Jeder 18-Jährige füllt einen Musterungsfragebogen aus. Bekundet er Interesse, in der Bundeswehr zu dienen, wird er zur Musterung eingeladen.
Einen sechsmonatigen „Freiheitsdienst“ schlagen bayerische Grüne vor, für alle zwischen 18 und 67 Jahren, unter dem nicht ganz unpathetischen Motto: Was kannst du für dein Land tun? Problem: Dazu müsste das Grundgesetz geändert werden, die nötige Zweidrittelmehrheit ist jedoch nicht in Sicht.
Zudem lehnen nicht wenige junge Leute einen solchen Pflichtdienst ab. Stattdessen müsse, so Juso-Chef Philipp Türmer, die Bundeswehr attraktiver werden: „Egal ob Pflege, Kita oder Bundeswehr: Wir brauchen gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen statt Zwangsdienste für Jugendliche.“ Noch radikaler drückt es Ole Nymoen, Autor des Bestsellers „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“, aus: Im Ernstfall würde er lieber in Unfreiheit leben, als für Freiheit zu sterben.
Freiwillig kommt günstiger
Das ist der Sound der postheroischen Gesellschaft. Den summten schon die Rekruten in den 1980er Jahren: Daran, dass die Bundeswehr festen Willens war, die DDR zu überfallen, glaubte dort keiner mehr, auch wenn anderes vorgetragen wurde. In bundesdeutschen Kasernen dürfte es ähnlich gewesen sein. In dieser Lage sei das größte Problem kultureller Art, sagt der bulgarische Politologe Ivan Krastev. Weil so lange Frieden geherrscht habe, sei Krieg undenkbar geworden.
Jetzt die Menschen auf einen Krieg vorzubereiten, sei ein großer Bruch. Bevor wir weiter abwägen zwischen Pflicht und Freiheit, hilft vielleicht die Frage nach den Kosten weiter: Was ist teurer – eine Berufsarmee oder eine Wehrpflichtigenarmee? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das ifo Institut kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis: Die Bundeswehr mit mehr Personal auszustatten, ist über eine Marktlösung gesamtwirtschaftlich deutlich günstiger als über die Wehrpflicht.
Und selbst wenn es doch etwas teurer werden sollte – genug Geld ist ja da.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
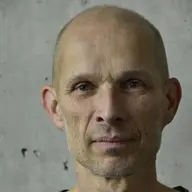









meistkommentiert