Debatte Israel-Palästina: Trumps Schwiegersohn auf Irrwegen
Jared Kushner sieht in der Wirtschaftsförderung die Lösung für den Nahost-Konflikt. Die politischen Knackpunkte ignoriert er.

D er „Deal des Jahrhunderts“ bleibt ein wohl gehütetes Geheimnis. Seit Monaten lässt US-Präsident Donald Trumps Friedensplan für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern auf sich warten. Irgendwann im Sommer soll er veröffentlicht werden.
Was genau das Dokument beinhalten wird, ist wohl selbst den Architekten des Plans noch nicht klar. Doch Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner, dem der US-Präsident das nahöstliche Monstervorhaben aufgeladen hat, stand in Washington kürzlich Rede und Antwort. Obwohl er wenige Details verriet, zeichnet sich die Richtung des Vorstoßes bereits ab.
Aufschlussreich ist eine Anekdote, in der Kushner ein Gespräch mit einem Unterhändler in Nahost schildert. „Er sagte: ‚Du musst in die Jahre 1917, 1948, 1967 und 1973 zurückgehen.‘ Und ich sagte einfach: ‚Schau: Wir wollen nicht in die Geschichte einsteigen, alles, was mich interessiert, ist heute.‘“ Die Gründungsgeschichte Israels, die Kriege mit den arabischen Nachbarn, all das interessiert Kushner nicht. Der 38-jährige Immobilienunternehmer strebt einen Deal an, der sich radikal unterscheidet von bisherigen Versuchen, den festgefahrenen Konflikt am östlichen Mittelmeer zu lösen.
Was bislang bekannt ist: Der Plan, an dem Kushner zusammen mit dem US-Nahostbeauftragten Jason Greenblatt und David Friedman, dem US-Botschafter in Jerusalem, arbeitet, wird Grundfesten des Friedensprozesses infrage stellen, teils komplett über Bord werfen – darunter die seit Jahrzehnten verfolgte Zweistaatenlösung, in deren Zentrum die Vision von zwei Staaten für zwei Völker steht, die sich Jerusalem als Hauptstadt teilen. Penibel vermeidet Kushner jedes Bekenntnis zu zwei Staaten. Das Wort „Selbstbestimmung“ nimmt er in den Mund, von eigener Staatlichkeit der Palästinenser redet er nicht.
Doch solch politische Fragen sind in Kushners Gedankenwelt ohnehin zweitrangig. Ihm schwebt ein ökonomisch begründeter Frieden vor: Verbessert sich die Lebensqualität der Palästinenser, so Kushners Credo, lösen sich auch die politischen Probleme, dann wird auch Israels Sicherheit garantiert sein. Mit einer Konferenz in Bahrain will er Ende Juni um Investitionen in die Palästinensergebiete werben.
Über Alternativen zur Zweistaatenlösung nachzudenken, ist nicht grundsätzlich falsch, denn realistisch ist der Ansatz heute kaum noch: Israelische Regierungen haben sich in den 1967 besetzten Gebieten so dauerhaft als herrschende Macht installiert, dass die Gründung eines palästinensischen Staats den Tausch größerer Gebiete und Umsiedlungen erforderte. Mehr als eine halbe Million Menschen wurden im besetzten Westjordanland sowie im palästinensischen Ost-Jerusalem angesiedelt. Das widerspricht zwar dem Völkerrecht, doch die Fakten sind geschaffen.
Kushners Plan jedoch, die Zweistaatenlösung aufzugeben, ohne eine Strategie zu formulieren, die grundlegende Gerechtigkeitsfragen angeht, ist realitätsfern. Kushner versucht, die Regeln seiner Geschäftswelt auf einen der komplexesten Konflikte der Erde anzuwenden. Selbst US-Außenminister Mike Pompeo bezeichnete das Vorhaben als „undurchführbar“ – nicht wissend, dass jemand seine Bemerkung mitschnitt.
Der Topdiplomat weiß, dass jeder Lösungsansatz ein in mühsamer Kleinstarbeit aufzubauendes Vertrauen der Konfliktparteien voraussetzt. Doch nichts weist darauf hin, dass Kushner einen vertrauensbildenden Prozess anvisiert, an dessen Ende irgendwann die großen Fragen des Nahost-Konflikts aufgetischt werden können: der Status Jerusalems, die Flüchtlingsfrage, die Siedlungen und die Grenzen.
Generationen von Palästinensern sind mit der Konfliktrealität aufgewachsen, mit dem festen Glauben, dass das eigene Volk von dem ihm zustehenden Land vertrieben wurde. Ein dauerhafter Frieden wird nicht möglich sein, ohne zum einen das Thema Staatlichkeit anzugehen und zum anderen die Gerechtigkeitsfrage zu stellen (das zumindest theoretische Recht auf Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge und damit verknüpfte Entschädigungsfragen).
Kushners Ansatz eines ökonomischen Friedens ignoriert zudem, dass unter anderem die EU bereits große Summen in die palästinensischen Gebiete investiert. Materiell geht es den Menschen im besetzten Westjordanland besser als so manchen ihrer arabischen Brüder – auch wenn die Führung in Ramallah korrupt ist und längst nicht alle Hilfen beim „Volk“ ankommen.
Nun könnte man den Kushner-Plan als dilettantisch abtun, als weitere Spinnerei aus dem Hause Trump. Doch das programmierte Scheitern wird Folgen haben. Die frühzeitige Ablehnung durch die Palästinenserführung kann man falsch finden, doch die Haltung ist verständlich in Anbetracht des bislang Bekannten sowie der von Trump auf die Spitze getriebenen antipalästinensischen Politik: Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt, Verlegung der US-Botschaft, Einstellung der Zahlungen für die Autonomiebehörde und das Palästinenserhilfswerk UNRWA sowie die Anerkennung der israelischen Annexion der Golanhöhen, die Washingtons frappierende Bereitschaft gezeigt hat, sich im Nahen Osten über internationales Recht hinwegzusetzen.
Scheitert der Plan, stünden die Palästinenser als Buhmänner da. Für die Regierung und andere rechte Kräfte in Israel wäre das eine Steilvorlage, um einige angekündigte Vorhaben im Alleingang durchzusetzen: die weitere Festigung der Kontrolle über Ost-Jerusalem oder eine Annexion palästinensischer Gebiete. Ein Scheitern des Kushner-Plans und dessen Folgen würden einen Kompromiss, der von einer Mehrheit der Israelis und Palästinenser wie auch im Ausland als gerecht akzeptiert wird, vollends unmöglich machen. An die Stelle einer ausgehandelten Lösung würde eine von der Macht des Stärkeren geprägte Regelung treten. Ein Friedensplan, der den Beinamen „Deal des Jahrhunderts“ verdient, sieht anders aus.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





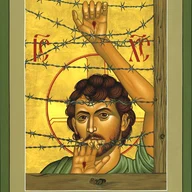



meistkommentiert
Tödlicher Polizeieinsatz in Oldenburg
Drei Schüsse von hinten
Zugesagte Aufnahme von Afghan*innen
Erneut verraten
Kampf gegen die Erderhitzung
In Europa macht sich der Klima-Fatalismus breit
Konsum von Geflügelfleisch
Der Chickenboom ist gefährlich für Mensch und Tier
Mindestlohn-Debatte in Koalition
15 Euro, wenn nötig per Gesetz
Verbot von Kaiserschnitten in der Türkei
Autoritäre Machtdemonstration