Vor den Parlamentswahlen: Was in Frankreich auf dem Spiel steht
Nach der Auflösung der Nationalversammlung steht Frankreich vor einer ungewissen Zukunft. Zwei sehr heterogene Blöcke ziehen in den Kampf.

Starker Mann der Rechten: Jordan Bardella von Rassemblement National am 19. Juni vor der Presse Foto: Michel Euler/ap
Dass in der Politik alles möglich ist, dass das, was gestern noch als völlig aussichtslos galt, morgen plötzlich Wirklichkeit werden kann, scheint sich diesmal wieder einmal zu bestätigen. Ausgerechnet hier in Frankreich, dem Land der Französischen Revolution und der Erklärung der Menschenrechte, dem Land von Descartes, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola und Jean-Paul Sartre, einem der Gründungsländer und Hauptpfeiler der Europäischen Union.
Einem Land, von dem man wirklich alles andere erwartet hätte als das, was nun geschieht. Mit der Entscheidung von Staatspräsident Emmanuel Macron, vorzeitig das Parlament aufzulösen, stürzt das Land in eine schwere politische Krise, die mit dem Wahlsieg der französischen Rechtspopulisten des Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und Jordan Bardella enden könnte.
Die umstrittene Auflösung der Nationalversammlung hat urplötzlich eine neue Dynamik geschaffen, allerdings mit außerordentlich hohen Risiken für die Demokratie und den Rechtsstaat, sollte das Kalkül der Rechtspopulisten aufgehen und sie stärkste Partei werden.
Um ihre Pläne zu durchkreuzen, haben sich nun schon am 13. Juni praktisch alle französischen Linksparteien in einem 24-Stunden-Marathon zur Volksfront, der Nouveau Front populaire, zusammengeschlossen, einem politischen Kampfbündnis, das vom rechten Flügel der Sozialisten über die Kommunisten und die Grünen bis zur radikal-revolutionären Linken der Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) reicht, mit einem Programm von radikalen Reformen, um dem RN den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Miese Aussichten für die Ukraine
Dazu gehört eine Kehrtwende für Macrons umstrittene Rentenreform, die Erhöhung des staatlich garantierten Mindestlohns auf 1.600 Euro monatlich, die Rücknahme der Gas- und Strompreiserhöhungen sowie die Wiedereinführung der Reichensteuer, die Macron abgeschafft hatte. Am Wahltag des 30. Juni wird sich herausstellen, ob die Linke mit diesem Programm ihre Stammwähler zurückgewinnen kann.
Außer Frage steht hier jedoch, dass unter den jetzigen Bedingungen der rechtsextreme Rassemblement National zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur die größte Parlamentsfraktion in der französischen Nationalversammlung stellen wird, sondern möglicherweise sogar eine absolute Mehrheit von mindestens 289 der insgesamt 577 Sitze. Aktuelle Prognosen deuten derzeit auf 230 Sitze.
Wahrscheinlicher ist vorläufig, dass der RN nur die relative Mehrheit der Parlamentssitze erringt und einen Partner aus dem bürgerlichen Lager braucht, um regieren zu können. Ein Kandidat dafür sitzt schon in den Startlöchern. Der Vorsitzende der rechtsbürgerlich-neogaullistischen Partei Les Républicains, Eric Ciotti, biederte sich bereits an, indem er ohne jede Absprache mit den Parteigenossen ein Wahlbündnis mit den Rechtsradikalen einging, was zu einem Skandal und schließlich dazu führte, dass die Konservativen ihn absetzten.
Natürlich würde eine rechtsextreme Regierung in Paris die Hilfe für die Ukraine sofort stoppen, und ähnlich wie Donald Trump in den USA, sollte er die Präsidentschaftswahlen für sich entscheiden, die Ukraine im Stich lassen und vermutlich sogar Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Kapitulation drängen. Unmittelbarer Auslöser für diesen Umschwung in Frankreich war das schlechte Abschneiden von Macrons Zentrumspartei bei der Europawahl, bei der die Liste des RN 32 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten hatte, Macrons Zentrumspartei jedoch nur 13 Prozent.
Hoffnung auf politischen Realismus
Diese Niederlage des Zentrums ermutigte die Rechtspopulisten dazu, eine sofortige Parlamentsauflösung und Neuwahlen zu fordern, eine Forderung, der der Präsident unglücklicherweise umgehend nachgekommen ist. Vermutlich trieb ihn die Illusion, seine Partei könne gestärkt aus diesen Parlamentsneuwahlen hervorgehen. In Wirklichkeit erwies sich seine Entscheidung als willkommenes Geschenk an die Rechtsextremisten, die damit sofort in die Offensive gingen.
Die Linksparteien reagierten bekanntermaßen mit dem Zusammenschluss zur Nouveau Front populaire, der Neuen Volksfront, die die Linkspopulisten der France insoumise (FI) umfasst, die Sozialistische Partei (PS) von Olivier Faure, die Grünen, die Kommunistische Partei (PCF) und die trotzkistische NPA. Meinungsumfragen zufolge könnte diese große Wahlplattform von fünf Linksparteien im ersten Wahlgang 30 Prozent der Wählerstimmen gewinnen, wohingegen der RN auf 40 Prozent käme.
Gelingt es der rechtsextremen Partei, mithilfe von Le Pen an die Regierung zu kommen, wäre das nichts anderes als ein erdrutschartiger Sieg der Rechtsradikalen, der die politische Landschaft in Frankreich total verändern würde. Es wäre ein noch nie dagewesenen Rechtsruck. Macron wäre dazu gezwungen, Jordan Bardella zum neuen Ministerpräsidenten zu ernennen.
Die neue, gefährliche, politische Konstellation ist die einer extremen Polarisierung: hier der vereinigte und durch das bürgerliche Lager zum Teil verstärkte Rechtsblock, dort die in der neuen Volksfront vereinigte Linke, die allerdings längst nicht homogen ist. Nach wie vor bestehen erhebliche politische Differenzen zwischen der sozialdemokratischen Partei, den Grünen und der linkssozialistisch-radikalen FI.
Anzumerken wäre noch, dass im Gegensatz zu dem früheren Wahlbündnis Nupes (Nouvelle union populaire ecologiste et socialiste) in der neu gegründeten Volksfront die politischen Gewichte verschoben sind. So ist die FI nicht mehr dominierend, wohingegen der Einfluss der Sozialisten und der Grünen erheblich zugenommen hat. Ihr politischer Realismus lässt darauf hoffen, dass die Volksfront bei den Parlamentswahlen letztendlich besser abschneiden wird als vorausgesagt.


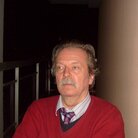



Leser*innenkommentare
J_CGN
Naja, Macron scheint sich gedacht haben: Als zweite Wahl kommt mein Verein in hinreichend viele Stichwahlen und da zieht wie immer das kleinere Übel.
Mit NFP steht jetzt aber eine linke Alternative bereit. Spannend wird die Entscheidung der bürgerlichen zwischen Rechts und Links. Vermutlich ist das für diese keine Frage: eben rechts...
Schaun mer mal.
nutzer
nun, so überraschend finde ich es nicht, erschreckend ja, aber es war abzusehen, dass es irgendwann so kommen muß. Macron hat sich als letztes Bollwerk gegen den FN verkauft, was auch gelungen ist, aber an seiner Politik festgehalten, ist vielen Menschen maximal auf die Füße getreten. Macron hat das Problem RN verschärft, nicht bekämpft.
Wieso die Linke daraus kein Kapital schlagen konnte ist eine andere Frage.
Markus Michaelis
Wieso war das nicht zu erwarten? Niemand kann heute die französische Bevölkerung repräsentieren - einfach weil es zu wenig gemeinsame Sichtweisen und Ziele gibt. Diese Entwicklung zeichnet sich seit sehr langem ab, schon Macron war der "letzte Notanker" nach dem Kollaps der alten Parteien. Macron vertritt glaube ich ganz gut den heute möglichen Kompromiss, aber auch damit ist er einer der meistverachteten Präsidenten - und jeder oder jede andere wäre es auch.
Meine Erwartung wäre, dass das auch noch lange so weitergeht, bis irgendwann die Bevölkerung sich wieder auf politische Gemeinsamkeiten einigen kann. Das kann aber auch noch eine Generation oder mehr dauern, weil die jetzige Bevölkerung einfach nicht genügend Gemeinsamkeiten hat und die Zeiten zu sehr im Umbruch sind, als dass man sich leich auf irgendwelche Sichtweisen einigen könnte.
Des247
Zusatz:
Die Wahlbeteiligung war nur um die 50%, ich kann nur hoffen, dass es dann doch vielleicht ein positive Überraschung gibt.
Mindestlohn in Frankreich momentan: 11.65 Euro brutto 9.23 Euro netto.
1 766 Euro brutto 1 398 Euro netto.
Wöchentliche Arbeitszeit 35 Stunden.
Über 200 Euro mehr netto würden sich viele freuen!
Des247
Macron hat einfach zu viele Fehler gemacht.
Das Rentenalter in Frankreich anzuheben ist tödlich, dass ist wohl der Hauptgrund. Da verstehen die Franzosen so gar keinen Spaß.
Dazu kam die angeordnete übermäßige Gewalt gegen Demos.
Reichensteuer abschaffen, ich glaube dazu muss ich nichts mehr sagen.
Dann hat er einen Waffenstillstand in Gaza gefordert, das wiederum hat den Rechten nicht gepasst.
Aber, anstatt aus dem Ergebnis Schlüsse zu ziehen, und dann etwas zu ändern, hat er die beleidigte Leberwurst gespielt und Frankreich in eine absolut kritische Lage gebracht.
Ich lebe in Frankreich, hoffentlich wirft mich Madame Le Pen nicht raus....
J_CGN
@Des247 Das waren keine Fehler, das war so genau Progtamm.
Kaboom
Bei Putin knallen schon die Champagner-Korken ...
Land of plenty
@Kaboom ja eben, deshalb habe ich auch einen roten Hals! Schon so lange geht das.
Land of plenty
Wie kann ich mir eine solche ad hoc Nouveau Front populaire vorstellen? Die haben doch keinerlei Gemeinsamkeiten. Das hält doch keine zehn Meter weit. Wer den RN verhindern will, muss ja selbst eine Regierung bilden.
France Insoumise ist auch nur Zarenknecht pur, anti-EU und linkskonservativ Arbeitereinkommen protegierend, gegen Geflüchtete.
Das ist keine NFP. Schon bei den letzten beiden regulären Wahlen gab es eine Viertelung der Lager: je 25%.
vieldenker
Die eigentliche Frage lautet ja, wie konnte es soweit kommen, dass due Franzosen sich wohl nur noch zwischen Rechter und linker Volksfront entscheiden können? Auch wenn die Verhältnisse im politischen Paris seit langem schon extremer sind, sollte uns diese Entwicklung auch hierzulande zu denken geben.
Land of plenty
Mir wird's schlecht.
Und die Parteien der Nouveau Front populaire {Linkspopulisten der France insoumise (FI) umfasst, die Sozialistische Partei (PS) von Olivier Faure, die Grünen, die Kommunistische Partei (PCF) und die trotzkistische NPA} kriegen zusammen weniger Stimmen als das rechte RN? Da fehlt noch was von 30+40 =70 auf 100%. Die Konservativen sind ja zerlegt, nicht so wie die CDU in Dt, sondern schon lange Zeit aufgeteilt, weshalb Macrons REM überhaupt eine Chance hatte.
Furchtbar. Für die Ukraine. Für alle.
Knuth W.
Es ist die französische Demokratie, die auf dem Spiel steht. Die Partei von Le Pen hat sich zum Wolf im Schafspelz gemausert und wird ihr wahres Gesicht, wie alle Rechtspopulisten nach der Übernahme der Amtsgeschäfte nicht mehr lange verbergen. Das sehen wir weltweit derzeit. Macron wagt ein "all in" mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen. Und einen "Léon Blum", wie in der ersten Version der Front Populaire in den 30ern des letzten Jahrhunderts, sehe ich derzeit nicht in Frankreich…
aberKlar Klardoch
"Was in Frankreich auf dem Spiel steht"
Falls die Rechtsradikalen bei der kommenden Wahl in Frankreich von einem Großteil der Bevölkerung Aufwind erhalten, könnte dies eine erschreckende Kettenreaktion in Deutschland und vielen anderen europäischen Staaten auslösen. Ich befürchte nichts Gutes, denn der allgemeine Trend, Rassisten und Rechtsextreme zu wählen, die Minderheiten am liebsten loswerden wollen, nimmt zu. Dies gilt übrigens nicht nur für europäische Staaten, und Rechtsextreme zu wählen, die Minderheiten am liebsten loswerden wollen, nimmt zu. Dies gilt übrigens nicht nur für europäische Staaten, sondern auch anderswo auf der Welt, wie z B. in den USA (Trump als nächster möglicher Präsident), Israel (Netanjahu und seine teilweise rassistischen Minister) und viele andere......
Barthelmes Peter
Ist es nicht zuvörderst ein Zeichen von Demokratie wenn ein unglücklich agierender Präsident bei nur 13 % Zustimmung der Wähler das Parlament auflöst ? Auch in Großbritannien wird es Neuwahlen geben nachdem die Konservativen in der Wählergunst deutlich verloren haben. Demokratie heißt nicht Aussitzen bis der Laden auseinanderfliegt !