Künstlerin Tilla Durieux: Männermordende Erotik
Das Georg Kolbe Museum in Berlin erinnert mit einer Ausstellung an den vergangenen Glamour der Tilla Durieux, die viele Künstler inspirierte.
Nicht weit entfernt vom Potsdamer Platz in Berlin liegt der Tilla-Durieux-Park: ein 50 Meter langes schmales Band von bescheidenem Grün zwischen Neubauten. Urbanes Leben, geschweige denn Glamour findet man dort eher nicht. Dabei soll der Park mit seinem Namen an eine der glamourösesten Frauen erinnern, die je in Berlin auf einer Bühne standen: Tilla Durieux.
Max Slevogt malte sie 1907 in aufgewühlten Farben als „Kleopatra“, lasziv auf Tigerfellen lümmelnd, die Lippen aufgeworfen, schimmernd das Kleid, die Finger exaltiert gespreizt, der Busen blass aus dem Dekolleté leuchtend. Franz von Stuck machte die Schauspielerin mit zurückgelegtem Kopf und geöffneten Lippen 1912 zu einer Ikone des Jugendstils: „Tilla Durieux als Circe“ steht auf dem Bild.
Der Malerfürst aus München sonnte sich dabei selbst ein wenig in ihrem Ruhm, reproduzierte das Bild vielmals als Postkarte, zum Missfallen der Schauspielerin. Der Bildhauer August Gaul, mit dem sie in Berlin befreundet war, setzte die Durieux hingegen als nackte Circe in einer kleinen Skulptur auf ein Schwein, ein Scherz mit dem Mythos der griechischen Zauberin Circe, die Männer in Schweine verwandeln konnte.
Die Spur der Schauspielerin in der bildenden Kunst ist groß. Und das liegt nicht nur daran, dass ihr erster Mann, Eugen Spiro, ein Maler gewesen war, der 1905 von ihr ein hinreißendes Bild als junge Frau im blauweißen Kleid auf einem blauweißen Sofa malte, das mehr nach Renoir aussieht als das Porträt, das der französische Impressionist seinerseits später von ihr malte. Und es liegt auch nicht nur daran, dass sie mit ihrem zweiten Mann, dem Kunsthändler Paul Cassirer, im Mittelpunkt des Berliner Kunstlebens stand, sondern ihre Kraft als inspirierende Muse liegt in der Spannbreite der Rollen, die sie auf der Bühne, im Film und im Leben spielte.
Männermordende Erotik, biblisch verbrämte Exotik

Davon erzählt die Ausstellung „Tilla Durieux – eine Jahrhundertzeugin und ihre Rollen“ im Georg Kolbe Museum anschaulich. Tilla Durieux, in Wien 1880 geboren, wurde schon sehr jung zum Star, 1903 am Theater von Max Reinhardt in Berlin, in der Rolle der Salome.
Das Stück von Oscar Wilde um eine Femme fatale war sowieso skandalumwittert, in England zunächst von der Zensur verboten, von männermordender Erotik und biblisch verbrämter Exotik geprägt. Wie sie Salome spielte, als fleischgewordene Fantasie, wie viel aufmüpfige Weiblichkeit sie in die Rolle der alle Regeln brechenden Prinzessin legte, lässt sich freilich nur ahnen. Dabei helfen Fotografien, die sie in antikisierenden Posen zeigen, schwer mit Schmuck behangen, Arme und Bauch nackt.
Etwas später tanzte sie Potiphars Weib in der „Josephslegende“ und galt als die Wunschbesetzung des Komponisten Richard Strauss. Ein Bild von Max Slevogt zeigt sie in dieser Rolle und eine 1922 entstandene Grafikmappe von Emil Pirchan lässt die expressiven Stilisierungen erahnen, die das Theater der Zeit eben auch ausmachten.
Doch Tilla Durieux’ Präsenz auf der Bühne, auch in schwärmerischen Kritiken belegt, ist nur die eine Seite, der die Ausstellung nachgeht. Sie stellt die Schauspielerin auch als politisch wache Frau vor, die sich für die Arbeiterbewegung engagierte, in der Hasenheide für Arbeiter las und Klavier spielte, mit Rosa Luxemburg befreundet war und sie finanziell unterstützte, und in der Zeit des Ersten Weltkriegs auch mal einen Mittagstisch für arme Künstler organisierte.
Rollenmodell der Emanzipation
Der Kuratorin Daniela Gregori gelingt es, ein Bild von Tilla Durieux auch als Rollenmodell der Emanzipation – eigenständig, erfolgreich, modern, zupackend – zu zeigen. Dazu gehört, dass sie Auto fahren liebte, Gletschertouren unternahm, im Fesselballon flog. Aber auch nähen konnte, Kostüme selbst schneiderte, sich private schlichte Tuniken entwarf: ein Stil, der mit dem Ablegen des Korsetts auch zumindest symbolisch versprach, Klassenschranken zu überwinden.
Wichtig wurden diese praktischen Fähigkeiten, als sie und ihr dritter Ehemann, Ludwig Katzenellenbogen, 1933 vor den Nationalsozialisten die Flucht ergreifen mussten. Katzenellenbogen war als Vorstand einer Brauerei der Bilanzfälschung angeklagt und sein Prozess wie viele in der Zeit von antisemitischen Tönen begleitet. Ihre Stationen im Exil sind abenteuerlich, 1934 kann sie in Prag Lady Macbeth spielen, zwei Jahre lang leiten (1936–38) beide ein Hotel in Abbazia in Kroatien: eine Fotoserie zeigt sie als Hotelchefin.
Das Passfoto zeigt sie in der Rolle als müde Tänzerin

Die Staatsbürgerschaft von Honduras soll bei der Beantragung für Visa helfen, Tilla Durieux nutzt als Passfoto erstaunlicherweise ein Bild, das sie in der Rolle einer armen und müden Tänzerin in einer Inszenierung des Theaterstücks „Treibjagd“ zeigt. 1941 wird ihr Mann von der Gestapo verhaftet und deportiert. Er stirbt später in Berlin. Sie bleibt in Zagreb im Exil, näht Kostüme für ein Puppentheater, von denen zwei in der Berliner Schau zu sehen sind, und unterstützt den antifaschistischen Widerstand.
Nicht umsonst trägt die Ausstellung „eine Jahrhundertzeugin“ im Titel. Als Tilla Durieux 1952 nach Berlin zurückkehrte, gelang ihr eine Alterskarriere. Sie spielte wieder Theater, in Filmen oder erzählte im Rundfunk aus ihrem Leben. Stefan Moses fotografierte sie 1963 durch die Äste eines kahlen Baums mit ihrem Lorgnon schauend, ein selbstironisches Altersporträt.
In einem kleinen Raum kann man sie in der Solofilmrolle einer alten und armen Frau erleben, die mit einem gekochten Hummer spricht und Rückschau hält. Ihr knochiges Gesicht ist noch immer markant, die Lebensspuren nutzt sie überzeugend für die Gestaltung der verbrauchten und einsamen Frau.
Als sie 1971 mit 90 Jahren in Berlin starb, hatte Tilla Durieux auch viele Auftritte als Zeitzeugin absolviert und späte Auszeichnungen in der Bundesrepublik erhalten. Doch das war vor über 50 Jahren. Der Kuratorin des Berliner Kolbe Museums liegt nun daran, das Interesse von jüngeren Generationen an ihr zu wecken.
Die Kunst der Selbstinszenierung
Die Chancen stehen gut, dies ist auch eine Schau über Mode und über die Kunst der Selbstinszenierung. Allein die Fotografien, auf denen sie sich mit Tieren zeigte, mit Hunden, Katzen und Papageien im Salon, aber einmal auch mit zwei jungen Leoparden an der Leine, dokumentieren eine Lust an der Mitgestaltung aufregender Bilder. Wie man Aufmerksamkeit bekommt, das wusste Tilla Durieux und das wussten ihre Fotograf:innen.
„Tilla Durieux – eine Jahrhundertzeugin und ihre Rollen“: Georg Kolbe Museum Berlin. Bis 20. August.
Katalog: 35 Euro
Was andere Künstler in ihr sahen, lag auch daran, was sie sehen wollten. Der Bildhauer Ernst Barlach kannte sie gut, beobachtete sie beim Rollenstudium, in ihren selbst geschneiderten Tuniken. Er war nicht an ihrer mondänen Seite und erotischen Ausstrahlung interessiert, sondern an der Ernsthaftigkeit, wie sie sich in ihre Rollen und Stoffe vertiefen konnte.
Seine Skulptur eines „Buchlesers“, der in einem schlichten Kittel (wie ihre Tuniken) über ein Buch gebeugt ein Bild der Versenkung darstellt, wird im Kolbe Museum als ein weiterer Beleg für die inspirierende Ausstrahlung der Durieux ausgestellt, eine Transformation der Freundschaft mit ihr.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






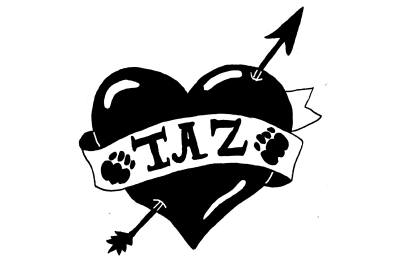
meistkommentiert
Internationale Strafverfolgung
Ein Schlag gegen das Völkerrecht
Koalitionsvertrag schwarz-rot
Immer schön fleißig!
Solarenergie wächst exponentiell
Das Zeitalter der Sonne wird keiner mehr stoppen
Siegfried Unseld und die NSDAP
Der geheime Schuldmotor eines Verlegers
Schwarz-rote Koalition
Als Kanzler muss sich Friedrich Merz verscholzen
Schwarz-rote Koalition
Was befürchtet wurde …