Alena Jabarine über Nahost-Debatte: „Auch in Deutschland ist Veränderung möglich“
Die Deutsch-Palästinenserin Alena Jabarine hat ein Buch über ihre Zeit in Ramallah geschrieben. Sie kritisiert die eingeengte Debattenkultur in Deutschland.

taz: Frau Jabarine, Sie haben zwischen 2020 und 2022 im Westjordanland gelebt und Ihre Erfahrungen in Ihrem Buch „Der letzte Himmel“ festgehalten. Was war Ihre Motivation für diese Reise?
Alena Jabarine: Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, die Familie meines Vaters sind Palästinenser:innen mit israelischer Staatsbürgerschaft. Ich kannte also die Realität von Palästinenser:innen in Israel in Ansätzen, aber nicht die von Millionen von Palästinenser:innen unter israelischer Militärbesatzung. Ich wollte mein Wissen und meine Erfahrungen erweitern. Als ich dann ein Jobangebot einer deutschen Stiftung in Ramallah erhielt, sah ich dies als Anlass, den Schritt zu wagen, ins Westjordanland zu ziehen.
taz: Sie waren also nicht für einen journalistischen Auftrag vor Ort?
Jabarine: Ursprünglich nein. Ich hatte mich bewusst nicht auf eine journalistische Stelle beworben, weil ich die deutsche Nahost-Berichterstattung als problematisch empfand. Aus Praktika und Gesprächen mit Korrespondenten vor Ort wusste ich, wie schwierig es ist, bestimmte Themen unterzubringen und wie viel Gegenreaktionen man allein dafür bekommt, Realitäten abzubilden. Journalist:innen mit persönlichem Bezug wird zudem häufig die Expertise abgesprochen, die Fähigkeit, „neutral“ zu berichten. Ich wollte meine Erlebnisse nicht durch den Filter der Verwertbarkeit betrachten, nicht dem Kontext der deutschen Debatte unterordnen. Vielmehr wollte ich meine Zeit dort als persönliche Erfahrung und Recherche begreifen.
ist Deutsch-Palästinenserin aus Hamburg. Nach ihrem Politikstudium in Hamburg und Barcelona absolvierte sie ein journalistisches Volontariat beim NDR und arbeitet seitdem als freie Journalistin. Sie lebte drei Jahre in Ramallah und hat darüber ihr erstes Buch geschrieben: „Der Letzte Himmel“, Ullstein Verlag, 384 Seiten, 23 Euro.
taz: Und dann?
Jabarine: Als im Mai 2021 ein neuer Krieg begann [Israel-Gaza-Konflikt 2021, auch Operation Guardian of the Walls genannt A. d. R.], habe ich noch deutlicher die enorme Diskrepanz erlebt zwischen dem, was ich selbst gesehen habe, und dem, was in Deutschland berichtet wurde. Das war für mich der Punkt, an dem ich mich entschied, doch zu berichten. Journalismus ist kein Job, nichts, für das ich mich entschieden habe, um Geld oder Applaus zu verdienen. Es ist eine Haltung und ein inneres Anliegen, es bedeutet auch, Verantwortung zu tragen. Also begann ich, zu dokumentieren und Videos von vor Ort auf Instagram zu teilen. Abstrakte Begriffe wie Siedlungen und Checkpoints zu bebildern, betroffene Menschen zu interviewen. Ich wusste, dass dies mein Leben nach meiner Rückkehr nach Deutschland verändern würde. Aber die Rückmeldungen, die ich aus Deutschland erhielt, zeigten mir, was für ein Mangel an der Dokumentation palästinensischer Lebensrealität in Deutschland herrscht.
taz: Sie beschreiben in Ihrem Buch Erlebnisse in Israel und Palästina vor dem 7. Oktober 2023. Wieso haben sie diese erst jetzt veröffentlicht?
Jabarine: Während meiner Zeit in Palästina fragten mich Freund:innen oft, wofür ich die ganzen Aufnahmen mache, abgesehen von flüchtigen Instagram-Stories. Doch ich wusste, dass die Geschichten, die ich mit meiner Kamera und meinem Mikrofon dokumentierte, ihren Platz finden würden. Wenige Wochen nach dem 7. Oktober schrieb ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über meine Kufiyah. Das Tuch, das für mich Familie, Heimat und warme Erinnerungen bedeutet, war nun plötzlich kriminalisiert, wurde als Symbol des Terrors bezeichnet. Dies stand sinnbildlich für das Gefühl, als Palästinenser:in in dieser Gesellschaft nicht sein zu dürfen. Auf den Artikel hin meldete sich ein Literaturagent. Ich ignorierte ihn, es waren traumatische Wochen, ich hatte einen Vollzeitjob und bekam plötzlich zahlreiche Anfragen von Formaten, die palästinensische Perspektiven zuvor wochenlang ausgeblendet hatten. Doch bald kristallisierte sich für mich heraus, dass die klassische journalistische Arbeit in Deutschland dem, was ich fühlte und tun wollte, nicht mehr gerecht wurde. Ich wollte ungefilterte, unbequeme Geschichten, erzählen. In dem System, in dem ich mich bewegte, gab es dafür keinen Raum. Also entschied ich mich, das Buch zu schreiben.
taz: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie in Deutschland oft einen ‚Filter‘ über sich legen, wenn Sie über Israel und Palästina sprechen. War dieser Filter auch beim Schreiben Ihres Buches präsent?
Jabarine: Als marginalisierte Menschen haben wir es gelernt, zu reagieren, uns immer wieder zu erklären oder zu rechtfertigen, in unserer Sprache mögliche Reaktionen zu antizipieren. Das geschieht unbewusst. Es war also meine größte Herausforderung, mich davon freizumachen. Zu versuchen, meine eigene Sprache wiederzufinden, in Kauf zu nehmen, dass Menschen sich dadurch gestört fühlen könnten. Aber ich wollte, dass das Buch wahrhaftig ist. Ich glaube daran, dass auch in Deutschland Veränderung möglich ist, dass wir klarer über das werden sprechen und berichten können, was passiert und was unsere Rolle in all dem ist. Aber dafür muss man immer wieder Grenzen überwinden, auch wenn das beängstigend und schmerzhaft sein kann.
taz: Sie haben ihre palästinensischen Wurzeln angesprochen, leben in Deutschland und besitzen einen israelischen Pass. Wie wirken sich diese drei Welten auf ihre Identität aus?
Jabarine: Es fällt schwer, mich in eine Schublade zu stecken. Ich habe sowohl eine deutsche, als auch eine palästinensische Familie, unter meinen vielen Familienmitgliedern gibt es Christen und Muslime, Konservative und Anarchisten, wir haben ein enges Verhältnis und debattieren eigentlich ständig. Seit meiner Kindheit weiß ich, dass Menschen unterschiedlich leben, sprechen, glauben. Und ich denke, dass das meine Arbeit prägt. Ich versuche, zu verstehen, warum Menschen tun, was sie tun, warum einige ihre Haltungen ändern und andere nicht, und auch mich selbst immer wieder zu hinterfragen. Gleichzeitig habe ich durch meinen israelischen Pass mehr Möglichkeiten als Millionen staatenloser Palästinenser:innen. Ich kann mein Heimatland bereisen und auch Kontakt zu jüdischen Israelis aufbauen, was vielen Palästinenser:innen verwehrt bleibt. Auch das ist ein Privileg und eine Verantwortung, Orte und Begegnungen durch mein Schreiben auch dorthin zu tragen, wo sie anderen verwehrt werden.
taz: Planen Sie ein weiteres Buch, das auch die Entwicklungen nach dem 7. Oktober aufgreift?
Jabarine: Ich werde weiterschreiben. Die Reaktionen auf das Buch haben mir einerseits verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Lebensrealitäten von Palästinenser:innen zu beschreiben und einzuordnen. Aber auch, welch verbindende Kraft insbesondere menschliche Geschichten haben können. Sie machen politische Zusammenhänge zugänglich, erwecken das Abstrakte zum Leben. Ich erlebe zudem, wie viel es Menschen, die unsichtbar gemacht werden, bedeutet, ein Buch in den Händen zu halten, das ihre Geschichten beinhaltet. Und auch wenn das Schreiben sich gerade in diesen Zeiten, während die Menschen in Gaza ausgehungert und in Massen getötet werden, sinnlos und fast schon anmaßend anfühlt, ich glaube an die Macht der Sprache, Veränderungen herbeizuführen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





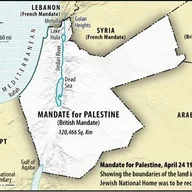
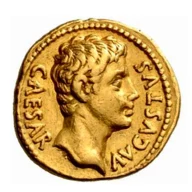
meistkommentiert
Günstiger und umweltfreundlicher
Forscher zerpflücken E-Auto-Mythen
Nach tödlichen Polizeischüssen
Wieder einmal Notwehr
NRW-Grüne Zeybek über Wohnungsbau
„Es muss einfach leichter werden, mehr zu bauen“
Verpflichtende KZ-Besuche in der Schule
Erinnern geht nur inklusiv
Fokus auf Gazakrieg
Solidarität heißt: sich den eigenen Abgründen stellen
Probleme bei der Deutschen Bahn
Wie absurde Geldflüsse den Ausbau der Schiene bremsen