Expertin zu Entwicklungshilfe und Corona: „Schädlicher als Corona selbst“
Corona sei für die Ärmsten verheerend, sagt die Präsidentin von Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel. Auch Hilfsprojekte seien betroffen.

Das einzige Beatmungsgerät im Krankenhaus von Koyom in Tschad wird im OP-Saal gebraucht Foto: Christoph Pueschner
taz: Frau Füllkrug-Weitzel, etwa 11 Prozent der Menschen auf der Welt hungern. Hat sich diese Zahl wegen der Coronapandemie erhöht?
Cornelia Füllkrug-Weitzel: Ja, die Zahl der Hungernden nimmt aufgrund von Corona zu. Die Ausgangsperren haben vielen Menschen von einem Tag auf den anderen ihr Auskommen genommen: Bauern und Bäuerinnen kommen nicht mehr aufs Feld, Tagelöhner, Straßenverkäuferinnen und viele andere, die im informellen Sektor arbeiten, verdienen nichts mehr und können sich kein Essen mehr kaufen.
Lässt sich bereits grob beziffern, wie sich diese Zusammenhänge auf die globale Hungersituation durchschlagen könnten?
Mehr als 300 Millionen Kinder bekommen wegen der Schulschließungen kein Schulessen mehr, oft war das die einzige Mahlzeit des Tages. Die Welternährungsorganisation geht davon aus, dass die Zahl der weltweit Hungernden um 80 Millionen Menschen zunehmen wird.
Wo entstehen derzeit die größten Notlagen?
64, ist Pfarrerin und Präsidentin von Brot für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe.
Die größten Probleme entstehen derzeit – leider – als Folge der wichtigen Schutzmaßnahmen. Die Ausgangssperren und Grenzschließungen sollen dazu dienen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das ist gut und richtig, weil die Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern unterfinanziert sind und schon im Normalfall bei Infektionen und chronischen Erkrankungen an ihre Grenzen stoßen. Zugleich führen die Schutzmaßnahmen jedoch dazu, dass große Teile der Bevölkerung unmittelbar in ihrer Existenz bedroht sind, weil sie über keinerlei soziale Absicherung verfügen und es für sie kein Kurzarbeitergeld oder eine andere Ersatzzahlung gibt.
In welchem Verhältnis steht die gesundheitliche Bedrohung zu diesen indirekten Folgen für die ärmsten Bevölkerungsgruppen?
Wir gehen davon aus, dass die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen mehr Schaden anrichten und auch mehr Menschenleben fordern werden als die Krankheit selbst. Besonders dramatisch wird sich die Krise dort auswirken, wo bewaffnete Konflikte herrschen.
Wie trifft Corona die Hilfsorganisationen?
Weltweit kommt es zu Einschränkungen wie Ausgangssperren oder Grenzschließungen, deshalb sind unsere Projektpartner in allen 90 Ländern betroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Auflagen genauso zu befolgen wie alle anderen. Wo jetzt nicht geerntet beziehungsweise ausgesät werden kann, wo Märkte geschlossen sind, werden Wege gesucht, die Zeit bis zum Wiederbeginn der geplanten Maßnahmen zu überbrücken und nach kreativen Möglichkeiten zu suchen, der Bevölkerung gegenwärtig beizustehen.
Passen Sie Hilfsprogramme derzeit also akuten Problemen vor Ort an?
Das hat für uns Priorität, denn gerade die Schwächsten, also Kinder und Frauen, alte Menschen, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten und alle, die in Armut leben, brauchen jetzt dringend Hilfe.
Lässt sich diese dramatische Lage aktuell überhaupt noch abfedern?
Ja, die dramatische Lage lässt sich abfedern, wenn die wohlhabenden Länder, und dazu zählen Deutschland und die EU, jetzt auch einen Schutzschirm für die Entwicklungsländer aufspannen. Die Corona-Krise ist global und kann deshalb auch nur global bewältigt werden. Je eher wir das begreifen, desto besser. Wir müssen etwa unbedingt alles Notwendige tun, um eine Ernährungskrise größeren Ausmaßes abzuwenden, wir dürfen nicht zusehen und abwarten.
Könnte Corona neben akuten Problemen auch dazu führen, das bereits erreichte Fortschritte in der Entwicklunsghilfe wieder zunichte gemacht werden?
Es ist absehbar, dass es Rückschläge geben wird. In vielen Projekte kommt es zu Verzögerungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Partnerorganisationen unterliegen ja auch den Ausgangssperren.
Was muss passieren, damit die Rückschläge nicht zu gravierend ausfallen?
Entscheidend wird neben der Frage der Mittel sein, ob und wie schnell zivilgesellschaftliche Organisationen weiterarbeiten können. Sie spielen eine wesentliche Rolle dabei, Menschen zu versorgen, die von staatlichen Maßnahmen nicht erreicht werden. Sie arbeiten mit Menschen, die im informellen Sektor tätig sind, in Slums leben oder als Minderheiten benachteiligt werden, wie etwa Indigene. Dort, wo Regierungen jetzt die Krise nutzen, um unliebsame Kritiker zum Verstummen zu bringen und die Zivilgesellschaft in ihrer Handlungsfreiheit – und damit auch Hilfefähigkeit – weiter einzuschränken, wird es mit Sicherheit Rückschläge geben.
Lassen sich aus der aktuellen Krise auch allgemeine Forderungen ableiten, um derartige Notlagen künftig besser abfedern zu können?
Generell sei gesagt: Es gibt kein besseres Mittel dagegen, dass solche Krisen sich global ausbreiten und dass sie Menschen in Armut stürzen, als mehr Mittel in die Basisgesundheitsversorgung und in die öffentliche Daseinsvorsorge weltweit zu investieren. Wir sehen das ja auch im eigenen Land!
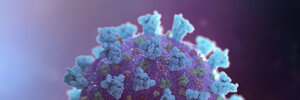








Leser*innenkommentare
tomás zerolo
Stattdessen investieren wir Geld darin, Menschen an den Grenzen abzuweisen (anstatt mitzuhelfen, dass sie zuhause eine Perspektive haben).
Wann begreifen wir endlich, was wir für eine Verantwortung tragen?
Holger Grahl
Das sehen die meisten aber nicht...
Tom Farmer
Es hätte mich gefreut, wenn auch eine Abschätzung gekommen wäre, wie denn unsere Schließungen der Geschäfte oder Produktionsstätten hier im industrialisierten Norden die Arbeitslosigkeit und deren weitere Folgen in den Ländern des globalen Südens befeuern; Stichwort abgeschnittene Lieferketten, Nachfragereduktion...