US-Gesundheitssystem und Corona: Der Hurrikan
Das auf Profit getrimmte Gesundheitssystem in den USA wird an Corona scheitern. Was jetzt zu tun ist.
D as Coronavirus ist wie ein alter Film, den wir schon mal gesehen haben. Richard Preston hat 1994 in seinem Buch „The Hot Zone“ den Dämon beschrieben, der aus einer Fledermaushöhle in Zentralafrika stammte und als Ebola bekannt wurde. Auf Ebola folgten 1997 die Vogelgrippe und 2002 SARS. In beiden Fällen trat das Virus zuerst in Guangdong, einem Produktionszentrum der globalen Ökonomie, auf.
Hollywood benutzte diese Epidemien, um Thriller zu inszenieren, die mit unseren Ängsten spielen. Steven Soderberghs „Contagion“, der 2011 wissenschaftliche Erkenntnisse über Pandemien verarbeitete, scheint das gegenwärtigen Chaos auf geradezu unheimliche Art vorweggenommen zu haben.
Mit Corona tritt also ein bekanntes Monster durch unsere Haustür. Die Sequenzierung seines Genoms (das SARS sehr ähnlich ist) war ein Kinderspiel. Trotzdem fehlen uns noch immer die wichtigsten Informationen. Drei große Herausforderungen sind zu bewältigen.
Erstens: Es mangelt eklatant an Tests, vor allem in den USA und Afrika. Deshalb sind verlässliche Schätzungen der wesentlichen Parameter – Reproduktionsrate, Zahl der Infizierten und Zahl der gutartigen Infektionen – fast unmöglich. Das Ergebnis ist das derzeitige Zahlenchaos.
Mike Davis
ist Soziologe und Historiker. Er lebt in San Diego, Kalifornien. 2005 erschien von ihm eine Studie über die Vogelgrippe. Bekannt wurde er mit "Planet der Slums".
Tödliches Risiko für ein Viertel der US-Bürger
Zweitens: Das Coranavirus mutiert, so wie auch die jährlichen Grippeviren. Das Virus, das US-Bürger befällt, unterscheidet sich bereits leicht von dem ursprünglichen Virus in Wuhan. Mutationen können die Krankheit mildern – oder ihre Virulenz verschärfen. Fakt ist derzeit: Gefährdet sind alle, die über 50 Jahre sind. Corana birgt damit für ein Viertel der US-Bürger – Ältere, solche mit schwachem Immunsystem oder chronischen Atembeschwerden – ein tödliches Risiko.
Drittens: Auch wenn das Virus stabil bleibt und kaum mutiert, kann sich Corona auf Jüngere in armen Ländern anders auswirken als derzeit vermutet. Denken wir an die Spanische Grippe, der 1918/19 circa 1 bis 2 Prozent der Menschheit zum Opfer fielen. In den USA und Westeuropa war das Virus der Spanischen Grippe für junge Erwachsene am häufigsten tödlich. Dies erklärte man sich lange so: Das stärkere Immunsystem der Jüngeren überreagierte auf die Infektion, griff Lungenzellen an und verursachte eine Lungenentzündung und einen septischen Schock. In jüngerer Zeit stellten einige Epidemiologen die Theorie auf, dass ältere Erwachsene möglicherweise eine Art Immungedächtnis von einem früheren Ausbruch in den 1890er Jahren hatten, das ihnen Schutz bot.
Die Spanische Grippe streckte in Armeelagern junge Soldaten zu Zehntausenden nieder. Die Epidemie wurde zu einem wichtigen Faktor im Weltkrieg. Die deutsche Frühjahrsoffensive 1918 in Frankreich brach auch wegen dieser Grippewelle zusammen. Die Alliierten konnten ihre kranken Divisionen mit neu angekommenen US-Soldaten auffüllen – ihre Feinde nicht.
Beispiel Spanische Grippe
In ärmeren Ländern hatte die Spanische Grippe Auswirkungen, die weniger bekannt sind. Fast 60 Prozent aller Opfer (also mindestens 20 Millionen Tote) lebten in Westindien, im Punjab und Bombay. Dort führten Dürre und die brutal erzwungenen Getreideexporte nach Großbritannien zu einer Nahrungsmittelknappheit, die für viele Ärmere Hunger bedeutete. So wurden Millionen Opfer einer finsteren Synergie von Unterernährung, die die Immunabwehr schwächte, und einer grassierenden viralen und bakteriellen Lungenentzündung.
Diese Geschichte sollte uns eine Warnung sein: Unterernährung und Infektionen können fatale Wechselwirkungen entfalten. Covid-19 kann in den dicht besiedelten Slums Afrikas und Südasiens andere Folgen haben als in Europa und den USA. Manche behaupten, dass die Pandemie in Afrika glimpflich verlaufen werde. Die städtische Bevölkerung in Afrika sei die global jüngste. Angesichts der Erfahrung von 1918 ist dies eine törichte Annahme, vergleichbar mit der Idee, dass die Pandemie, wie eine saisonale Grippe, mit wärmeren Temperaturen schon zurückgehen werde. Es gibt Coronaviren bereits in Lagos, Kigali, Addis Abeba und Kinshasa. Doch weil Tests fehlen, werden wir noch lange Zeit nicht wissen, wie das Virus und lokale Gesundheitsbedingungen zusammenwirken.
In einem Jahr werden wir voller Bewunderung auf Chinas Erfolg bei der Eindämmung der Pandemie zurückblicken (wenn die offiziellen Zahlen aus China über den raschen Rückgang der Infektionen stimmen). Und wir werden erschüttert sein über das Versagen der USA. Eine Überraschung ist das nicht: In Krisensituationen sind seit zwanzig Jahren Desaster in der Gesundheitsversorgung eher Regel als Ausnahme.
Schon bei den Grippeepidemien 2009 und 2018 waren viele Krankenhäuser überlastet. Um Gewinne zu maximieren, waren Krankenhausbetten sukzessive abgebaut worden. Nach Angaben der American Hospital Association ging die Zahl der stationären Krankenhausbetten von 1981 bis 1999 um 39 Prozent zurück. Das Ziel war es, eine Auslastung von 90 Prozent der Betten zu erreichen. Deshalb sind Krankenhäuser für Epidemien und Notfälle nicht mehr gerüstet.
Nach 1999 wurde zudem die Notfallmedizin im privaten Gesundheitssystem heruntergefahren, um kurzfristig Gewinne zu erhöhen. Auch im öffentlichen Sektor wurde gespart und gekürzt. Das Ergebnis: Derzeit gibt es in den USA nur 45.000 Betten in Intensivstationen. Das sind zu wenige, um der prognostizierten Flut schwerer Corona-Fälle Herr zu werden. In Südkorea gibt es im Verhältnis zur Bevölkerung mehr als dreimal so viele Intensivbetten.
Krasse Klassenspaltung
Auf uns kommt ein Hurrikan zu. Wir befinden uns am Beginn eines Desasters, das dem vergleichbar ist, was der Hurrikan „Katrina“ 2005 in New Orleans anrichtete. Weil nicht in die medizinische Notfallvorsorge investiert wurde, fehlt es an fast allem: elementaren Versorgungsgütern, Notfallbetten, Tests und Schutzausrüstung für Pfleger und Krankenschwestern.
Corona legt zudem eine krasse Klassenspaltung bloß. Wer von zu Hause aus arbeiten kann und über eine gute Krankenversicherung verfügt, ist geschützt. Doch 45 Prozent der Arbeitnehmer in den USA haben kein Anrecht auf bezahlte Krankheitstage. Sie müssen sich entscheiden, ob sie die Infektion womöglich übertragen oder bald nichts mehr auf dem Teller haben. Die Demokraten haben, angeführt von Bernie Sanders, Trump und die Republikaner nun dazu genötigt, als Notmaßnahme einer bezahlten Krankschreibung zuzustimmen. Die hat allerdings Schlupflöcher. Und Obdachlose sowie Millionen von Geringverdienern im Dienstleistungssektor werden den Wölfen zum Fraß vorgeworfen.
Wie tödlich das privatisierte Gesundheitssystem ist, zeigt insbesondere die gewinnorientierte Pflegeheimindustrie, die 2,5 Millionen ältere US-Bürger versorgt. Niedrige Löhne, zu wenig Personal und illegale Kostensenkungen sind typisch für diese Branche. Das hat auch ohne Corona Folgen. Zehntausende sterben jedes Jahr, weil die Pflegeheime grundlegende Infektionskontrollen vernachlässigen – ein Umstand, den man als vorsätzlichen Totschlag bezeichnen muss. Insbesondere in den Südstaaten zahlen viele Pflegeeinrichtungen lieber Strafen, als die Hygienevorschriften einzuhalten oder ausreichend Pflegepersonal einzustellen.
Es ist keine Überraschung, dass die Pandemie in den USA in einem Pflegeheim ausbrach: dem Life Care Center in Kirkland, einem Vorort von Seattle. Jim Straub, ein Gewerkschaftsorganisator in Pflegeheimen rund um Seattle, hält das Life Care Center für „eine der am schlechtesten ausgestatteten Einrichtungen des Staates“ und das Pflegeheimsystem insgesamt für das „am stärksten unterfinanzierte des Landes – eine absurde Oase des Leidens in einem Meer von Geld“ [Seattle ist ein Zentrum der IT-Industrie, Microsoft und Amazon haben dort ihren Sitz. Anm. d. Red.]. Laut Straub ist es auch nicht erstaunlich, dass sich das Virus so rasch vom Life Care Center in Kirkwood auf zehn nahe gelegene Pflegeheime verbreitete: Die Pflegekräfte arbeiten in der Regel in mehreren Heimen – gezwungenermaßen, denn in Seattle sind die Mieten extrem hoch.
Pflegeheime als Corona-Hotspots
In den USA werden Dutzende, wahrscheinlich Hunderte Pflegeheime zu Corona-Hotspots werden. Viele Pflegekräfte werden zu Hause bleiben und lieber Lebensmittel von Tafeln beziehen, als unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Dann könnte das gesamte Pflegesystem zusammenbrechen. Wir sollten nicht erwarten, dass die Nationalgarde Bettpfannen leert.
Corona zeigt, dass wir „Medicare for All“ brauchen, eine flächendeckende, umfassende Krankheitsversorgung. Zudem rächt sich, dass die großen Pharmakonzerne die Entwicklung neuer Antibiotika und antiviraler Mittel weitgehend aufgegeben haben. Herzmedikamente, süchtig machende Beruhigungsmittel und Pillen gegen Impotenz versprechen mehr Profit als Mittel gegen Infektionen im Krankenhaus. Wir müssen Arzneimittelmonopole aufbrechen und die gemeinnützige Produktion von Medikamenten mit lebenswichtiger Wirkung ermöglichen.
Doch angesichts von Corona müssen wir noch weitergehen. Die kapitalistische Globalisierung scheint biologisch unhaltbar zu sein, wenn es keine internationale öffentliche Gesundheitsinfrastruktur gibt. Das erfordert eine ehrliche Bewertung der politischen und moralischen Schwächen der Linken. Es ist erfreulich, dass sich viele Jüngere in den USA seit der Occupy-Bewegung für mehr Verteilungsgerechtigkeit engagieren. Doch es gibt in der fortschrittlichen Bewegung auch eine beunruhigende nationale Verengung, die mir manchmal wie die linke Version von „America First“ vorkommt.
Corona erinnert uns an die Dringlichkeit internationaler Solidarität. Wir brauchen jetzt eine massive Ausweitung der Produktion von Testgeräten und Schutzmitteln und kostenlose Medikamente für arme Länder. Wir müssen dafür sorgen, dass „Medicare for All“ sowohl zur Innen- als auch zur Außenpolitik wird.
Dieser Text erschien zuerst unter dem Titel „In a plague year“ in der US-Zeitschrift „Jacobin Magazine“ und ist eine aktualisierte und gekürzte Version. Bearbeitet und übersetzt aus dem Englischen von Stefan Reinecke
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










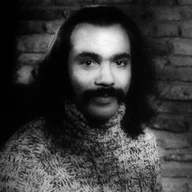
meistkommentiert
Hybride Kriegsführung
Angriff auf die Lebensadern
Kinderbetreuung in der DDR
„Alle haben funktioniert“
Niederlage für Baschar al-Assad
Zusammenbruch in Aleppo
„Männer“-Aussage von Angela Merkel
Endlich eine Erklärung für das Scheitern der Ampel
Sport in Zeiten des Nahost-Kriegs
Die unheimliche Reise eines Basketballklubs
Eine Chauffeurin erzählt
„Du überholst mich nicht“