Reform des Bundesverfassungsgerichts: Resilienz für die Roten Roben
SPD, Grüne, FDP und CDU/CSU wollen das Bundesverfassungsgericht vor der AfD schützen. Grund sind Erfahrungen aus Polen und Ungarn.

Das Bundesverfassungsgericht soll besser vor der Einflussnahme von Verfassungsfeinden geschützt werden. Darauf haben sich die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU geeinigt. Bis Ende des Jahres soll das Grundgesetz entsprechend geändert werden.
Ausgangspunkt der Diskussionen war die Erfahrung in Ungarn und Polen, wo die autoritären Regierungen möglichst kurz nach ihrer Wahl das jeweilige Verfassungsgericht auf Linie brachten, um dessen unabhängige Kontrolle auszuschalten. Möglich war das, weil in Polen und Ungarn die Verfassungsrichter:innen mit einfacher Mehrheit gewählt werden. Das heißt, die Regierungsmehrheit konnte ihr genehme Verfassungsrichter wählen.
Um die Mehrheit im Verfassungsgericht möglichst schnell zu erringen, senkte Ungarn das Pensionsalter, sodass schnell viele Richter:innen neu gewählt werden mussten. In Polen ging die PiS-Regierung anders vor: Sie blockierte das Gericht, indem sie ihm vorschrieb, die Fälle in der Reihenfolge ihres Eingangs bei Gericht abzuarbeiten statt nach Relevanz.
Um zumindest manche dieser Strategien zu verhindern, soll nun das Grundgesetz geändert werden. Manche der geltenden Strukturmerkmale des Bundesverfassungsgerichts sollen ausdrücklich in der Verfassung geregelt werden: die zwölfjährige Amtszeit der Richter, die Altersgrenze von 68 Jahren, dass es zwei Senate mit insgesamt 16 Richtern gibt, dass diese nicht wiedergewählt werden können, dass ein Verfassungsrichter sein Amt behält, bis die Nachfolgerin gewählt ist, dass Urteile des Verfassungsgerichts bindend sind und dass das Gericht seine Geschäftsordnung selbst regelt.
Ein entscheidender Punkt fehlt
Die AfD – oder eine andere extreme Partei – könnte dann also selbst mit einer Mehrheit im Bundestag nicht (wie in Ungarn) das Pensionierungsalter der Richter absenken oder dem Gericht (wie in Polen) eine bestimmte Reihenfolge seiner Arbeit auferlegen.
Allerdings fehlt ein entscheidender Punkt: Dass die Verfassungsrichter mit Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden müssen, soll nicht im Grundgesetz stehen. Die AfD könnte mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag also weiterhin das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht so ändern, dass künftig eine einfache Mehrheit für die Verfassungsrichterwahl genügt. Sodann könnte die AfD mit ihrer einfachen Mehrheit die Hälfte der Verfassungsrichter ohne Absprache mit anderen Fraktionen allein wählen. Die andere Hälfte wählt der Bundesrat.
Der Grund für diese Inkonsequenz: Dass die AfD demnächst über eine absolute Mehrheit im Bundestag verfügt, ist unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie – möglicherweise zusammen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht – mehr als ein Drittel der Mandate bekommt. Dann hätte sie eine Sperrminorität und könnte verlangen, dass auch sie einen oder zwei Verfassungsrichter:innen vorschlagen darf. Derzeit sind die Vorschlagsrechte für die 16 Richterposten auf CDU/CSU (6), SPD (6), Grüne (2) und FDP (2) aufgeteilt.
Gefährliche Hintertür
Um ihre Forderung durchzusetzen, könnte sich die AfD weigern, Vorschläge von anderen Fraktionen zu wählen. Auf lange Sicht wäre so die Arbeitsfähigkeit des Verfassungsgerichts gefährdet. Es wäre deshalb verlockend, in dieser Konstellation doch die Wahl der Verfassungsrichter mit einfacher Mehrheit zuzulassen, obwohl man dies eigentlich vermeiden wollte.
Eigentlich muss sich das Bündnis der vier Fraktionen diese gefährliche Hintertür aber gar nicht offenlassen. Denn sein Vorschlag sieht bereits eine effektive Möglichkeit vor, eine Blockade der Richterwahl im Bundestag aufzulösen. Wenn binnen sechs Monaten nach Ende der Amtszeit die Wahl eines Nachfolgers nicht gelingt, soll statt dem Bundestag der Bundesrat wählen.
Die Gefahr, dass die AfD dort auch eine Sperrminorität von einem Drittel erreicht, ist deutlich geringer: Es würde nicht einmal genügen, dass die AfD in allen ostdeutschen Bundesländern inklusive Berlin an der Regierung beteiligt ist. Die etablierten Parteien sichern so, dass sie die AfD nicht an der Verfassungsrichterwahl beteiligen müssen, ohne das Erfordernis einer Zwei-Drittel-Mehrheit abzusenken.
Der Kompromiss als heikles Projekt
Der gleiche Ersatzwahlmechanismus soll umgekehrt auch gelten, wenn die Verfassungsrichterwahl im Bundesrat blockiert ist und im Bundestag nicht. Das ist allerdings recht unwahrscheinlich.
Vertreter:innen der vier Fraktionen stellten die Einigung am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) vor. „Es ist ein guter Tag für die Verfassungskultur im Land“, freute sich Buschmann. „Jetzt ist der Rechtsstaat noch besser gegen Verfassungsfeinde abgesichert“, bilanzierte SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner.
Tatsächlich war es über Monate hinweg gelungen, die Arbeit an dem Kompromiss vertraulich zu halten. Das Projekt war heikel, weil die CDU/CSU im Februar schon einmal ausgestiegen war. Fraktionschef Friedrich Merz bekam daraufhin aber soviel Gegenwind, auch aus der eigenen Fraktion, dass er schnell zurückruderte.
Der gemeinsame Gesetzentwurf soll nun den Fraktionen vorgestellt und dann von diesen in den Bundestag eingebracht werden. Bis Ende des Jahres sollen die Grundgesetzänderungen in Bundestag und Bundesrat beschlossen sein. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit haben SPD, Grüne, FDP und CDU/CSU. Noch.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










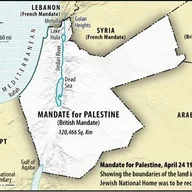

meistkommentiert
Ricarda Lang über Strategie der Grünen
„Die Schuldenlast tragen die Falschen“
Riot Dogs in der Türkei
Wenn selbst Hunde für den Widerstand bellen
Immer mehr Kirchenaustritte
Die Schäfchen laufen ihnen in Scharen davon
Sicherheitslage in Europa
Wettrüsten verhindern
Schlechte Zahlen der Deutschen Bahn
It’s Daseinsvorsorge, stupid
Zukunft des ÖPNV
Deutschlandticket trägt sich finanziell selbst