Micha Brumlik über Günter Grass: „Typisch für seine Generation“
Der Publizist Micha Brumlik über Günter Grass’ Umgang mit der eigenen sowie der deutschen Schuld und antisemitische Stereotype.

taz: Herr Brumlik, war Günter Grass ein Antisemit?
Micha Brumlik: Das glaube ich nicht. Aber Grass war ein Mensch, der auf eine verklemmte Art und Weise mit dem Problem der deutschen Schuld nicht fertig geworden ist.
Er hat seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS jahrzehntelang verschwiegen.
Das deutet auf ein unterdrücktes Schuldgefühl hin. Aber dann glaubte er vor drei Jahren, mit seinem Gedicht „Was gesagt werden muss“ darauf aufmerksam machen zu müssen, dass eine mögliche Auslöschung des iranischen Volkes durch Israel drohe. Mit der damaligen Realität zwischen Israel und Iran hatte das allerdings nichts zu tun.
War Grass’ Umgang mit seiner eigenen Geschichte zugleich auch typisch für viele Deutsche?
Es war typisch für viele Angehörige seiner Generation. Grass hat die deutsche Schuld sehr ernst genommen. Aber diese Schuld war zugleich schwer zu ertragen. Psychologisch kann man das damit erklären, dass man darauf verweist, dass auch andere ähnlich Schuld auf sich geladen haben.
Grass lehnte U-Boot-Lieferungen an Israel ab.
Grass kritisierte in dem Gedicht auch die Bundesrepublik, sein eigenes Land, weil die ein weiteres U-Boot nach Israel liefern wollte. Er spricht in seinem Gedicht davon, dass diese Lieferung Teil eines Verbrechens werden könnte und dass solche Hinweise als antisemitisch kritisiert würden. Das bedeutet, er fürchtete sich vor einer zweiten deutschen Schuld.
Jahrgang 1947, ist Publizist und emeritierter Professor am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Sind das nicht antisemitische Stereotypen?
In gewisser Weise ja. Die Denkfigur, dass das, was die Israelis heute vorhätten, vergleichbar oder identisch mit dem sei, was die Deutschen den Juden angetan haben, ist ein antisemitisches Stereotyp.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





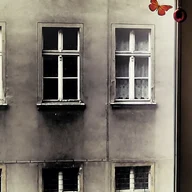








meistkommentiert