Mehrsprachliche Bildung: Sprache und Macht
Die Romanautorin Olga Grjasnowa hat ein Plädoyer für die Anerkennung von Mehrsprachigkeit vorgelegt. Es verläuft jenseits weniger Prestigesprachen.
Dass Mehrsprachigkeit eine Ressource ist, darüber sind sich wohl die meisten einig. Im multilingualen Europa wird das Sprachenlernen mit dem Ziel gefördert, dass sich jede*r neben der Erstsprache in zwei weiteren Sprachen verständigen kann. Bildungsbürgerliche Eltern bemühen sich für ihre Zöglinge um Plätze in bilingualen Kindergärten und Schulen. Nur leider gibt es davon viel zu wenige, zumindest solche, die staatlich gefördert werden.
„Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule“ (I. Gogolin) wurde schon vor über einem Vierteljahrhundert diagnostiziert und obwohl sich seither einiges bewegt hat, etwa Deutschlands klares Bekenntnis, ein Einwanderungsland zu sein, hat die grundsätzliche Orientierung des Bildungswesens an der Einsprachigkeit und das gleichzeitige Desinteresse an mehrsprachiger Kompetenz heute noch Gültigkeit.
Dazu kommt eine defizitäre Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit: Nicht alle Sprachen sind gleichermaßen wertgeschätzt und erwünscht. Die Minorisierung des Türkischen oder Arabischen im Vergleich zu Sprachen wie Englisch, Französisch oder auch Mandarin verrät uns viel über die Machtbeziehungen zwischen verschiedenen Gruppen und Hierarchisierungen von Herkunftsländern.
Womit zwei Kernaussagen des ersten Sachbuchs der erfolgreichen Roman- und Bestsellerautorin Olga Grjasnowa umrissen wären. Grjasnowa legt kein per se philosophisches Buch vor, auch wenn sie sich auf Jacques Derrida und Judith Butler beruft. Es ist auch kein streng wissenschaftlicher Text, der sorgsam sämtliche Forschungsergebnisse zum Thema versammelt, was nicht bedeutet, dass die einschlägige Literatur keine Erwähnung findet.
Die Macht der Mehrsprachigkeit
Die „Macht der Mehrsprachigkeit“ ist ein Essay, der auch viele persönliche Erfahrungen und Beschämungen preisgibt. Wie fühlt es sich an, wenn das Sprachförderungskonzept der Regelschule darin besteht, Schüler*innen ohne ausreichende Deutschkenntnisse ein bis mehrere Jahre zurückzustufen und dabei natürlich selbstredend keine weiteren zielführenden Förderungsmaßnahmen anzubieten? Wie ist es, gesagt zu bekommen, dass man in Deutsch leider nie ein „sehr gut“ bekommen werde, weil man ja mit leichtem Akzent spräche?
Olga Grjasnowa: „Die Macht der Mehrsprachigkeit“. Dudenverlag, Berlin 2021, 128 S., 12 Euro
Wie verunsichert werden Eltern mehrsprachiger Kinder, wenn ihnen in Kindergärten und Schulen gesagt wird, die Kinder hinkten in der Sprachentwicklung den monolingualen Kindern hinterher und nicht dazu gesagt wird, dass das bei mehrsprachigen Kindern häufig beobachtet wird und eben kein Anlass zur Beunruhigung sein muss, weil diese Kinder zwei oder mehr Sprachsysteme gleichzeitig erwerben.
Diese Beispiele verleihen der „Macht der Mehrsprachigkeit“ ein ganz besonderes Gewicht. Denn den Leser*innen nachvollziehbar und nachfühlbar zu machen, was es bedeutet, immer wieder Diskriminierungen einstecken zu müssen, weil in den Bildungsinstitutionen und in der Mehrheitsgesellschaft ein überwiegend uninformierter Umgang mit dem Thema Mehrsprachigkeit und Spracherwerb vorherrschen, erzeugt eine besondere Schubkraft.
Gesellschaftlicher Wandel
Theoretische Einsichten und Forschungsergebnisse, die seit Jahrzehnten vorliegen, scheinen allein nicht auszureichen, um einen gesellschaftlichen Wandel zu bewirken.
Grjasnowas Essay ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, Mehrsprachigkeit, nicht einige Prestige-Sprachen, endlich umfassend als Ressource anzuerkennen und diese Wertschätzung konsequent in den Bildungsinstitutionen umzusetzen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





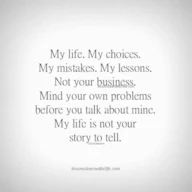
meistkommentiert