Kulturwissenschaftlerin über Sklaverei: „Philosophen waren selbst Täter“
Iris Därmann hat sich mit der Geschichte des Widerstands Schwarzer Menschen gegen Sklaverei befasst. Und mit der Haltung der westlichen Denker.
taz: Frau Därmann, „Die legitime proletarische Revolution sollte weiß sein“, fassen Sie Karl Marx ’ Haltung zur Sklaverei und der Selbstbefreiung der Sklaven zusammen. Wie kam der Befreiungsklassiker Marx zu dieser Einschätzung?
Iris Därmann: Ein Anliegen meines Buchs ist es, die Verstrickung politischer Philosophen mit der Sklaverei aufzuzeigen. Philosophen der Neuzeit und der Antike haben sich nicht nur auf die Seite der Täter geschlagen und die Gewalt der Versklavung legitimiert, sondern waren auch selbst Täter. Teils haben sie, wie Aristoteles, Sklaven gehalten, teils haben sie, wie John Locke, am transatlantischen Sklavenhandel verdient. Marx hatte ich schon lange nicht mehr gelesen, und ich dachte: Bei Marx wird alles anders!
Und dann?
Als ich sein Werk, auch die private Korrespondenz wiedergelesen habe, ist mir klar geworden, dass Marx zwar gut unterrichtet war über die Haitianische Revolution, die revolutionäre Selbstbefreiung der SklavInnen in der französischen Kolonie Saint-Domingue, aus der Haiti 1804 als erster schwarzer Nationalstaat hervorging. Zu meinem Erstaunen entdeckte ich aber, dass Marx – parallel zu seiner Berichterstattung über den US-amerikanischen Bürgerkrieg – die schwarze gegen die „weiße Sklaverei“ ausspielt. Er findet offensichtlich, dass die Versklavten in den Südstaaten gegenüber den weißen LohnarbeiterInnen in ihrem Kampf um den 8-Stunden-Tag zu viel Aufmerksamkeit erhalten.
Im „Kapital“ entwickelt er daher Lektüreverfahren, um die Aufmerksamkeitsökonomie zu verschieben. Wenn er zeitgenössische Literatur zur Plantagenökonomie zitiert, fordert er seine LeserInnen auf: „Lies statt Sklavenhandel Arbeitsmarkt“, ersetze „Sklave auf der Plantage“ durch „weißer Lohnarbeiter“ in englischer Fabrik. Er hat das Leid der SklavInnen durch das Leid der ArbeiterInnen überschrieben. Maßgeblich war für Marx der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Davon versprach er sich eine „totale Revolution“, die die gesamte Menschheit befreien werde, während die SklavInnen durch Flucht und Aufstände nur sich selbst befreien würden.
geboren 1963, ist Professorin für Kulturtheorie und Kulturwissenschaftliche Ästhetik an der Humboldt-Universität Berlin
Die Sklaven sind sozusagen egoistisch identitätspolitisch unterwegs?
Eine Art Überbietungswettkampf, ja. Man hätte sich vorstellen können, dass Marx den Kampf der Schwarzen und den des europäischen Proletariats miteinander verschränkt, im Sinne eines Trans- bzw. Black Atlantic, der Widerstandspraktiken afrikanischer, amerikanischer, karibischer und britischer Herkunft zu einer neuen revolutionären Kultur verbindet. Aber im „Kapital“ marginalisiert er die Widerstandspraktiken der Schwarzen: Rebellion, Streik, Flucht, Zerstörung von Ernten und Ackergeräten. Marx denkt die Sklaverei ökonomistisch: Für die Differenzen, die zwischen einem gewaltsam versklavten, „sozial toten“ Menschen und einem ausgebeuteten Lohnarbeiter bestehen, der ein Recht auf seinen eigenen Namen, seinen Körper, seine Sprache und Familie hat und der doch immerhin entlohnt wird – dafür zeigt er keine Sensibilität.
Haben Sie auch Positives bei Marx entdeckt?
Ja. Was er in besonderer Weise anprangert, ist die Kinderarbeit in England. Er hat die arbeitenden Kinder selbst zu Wort kommen lassen: Sie schildern ihren Fabrikalltag, ihre Schmerzen und Entbehrungen. Marx entwickelt gewissermaßen eine Kritik des Kapitalismus, ausgehend vom Standpunkt der Kinder. Dem „Global Slavery Index“ zufolge leben heute weltweit rund 40 Millionen Menschen in moderner Sklaverei; Menschen werden auf öffentlichen Märkten ge- und verkauft zu Zwangsarbeit, Zwangsehen, Zwangsprostitution, Organhandel. Frauen sind mit 71 Prozent, Kinder mit 25 Prozent betroffen. Das ist die Rückseite der westlichen Konsum- und Dienstleistungsgesellschaften. Auch für eine Gegenwartskritik des globalen Kapitalismus aus der Perspektive von Kindern kann man sich auf Marx berufen.
Ist es denn überhaupt angemessen, historische Denker an modernen Maßstäben zu messen?
Mir begegnet manchmal der Vorwurf der „moralischen Masturbation“. Mal abgesehen von der Wortwahl: Die Leute, mit denen ich mich beschäftige, nehme ich beim Wort. Wenn ein Klassiker wie John Locke sagt, alle Menschen sind gleich und frei geboren – dann hat er selbst ein universales Menschenrecht formuliert, das ihn jedoch nicht daran hindert, die Sklaverei zu legitimieren. Das Gleiche gilt für Marx und andere Denker, die universale Rechte formulieren, um sie dann wieder rassistisch aufzuteilen. Die Universalität der Menschenrechte eröffnet eine Demokratisierungsdynamik, die an kein Ende gelangen darf. Sie ist ein Prozess, der durch alle Organisationen, Institutionen, sozialen Medien, Verhältnisse hindurchgehen muss. „Mehr Demokratie wagen“ im Sinne Willy Brandts ist die zentrale politische Aufgabe: Die kommende Demokratie wird diversitätspolitische Ansprüche nicht gegen soziale, ökonomische und klimapolitische Gerechtigkeitsforderungen ausspielen.
Seit einiger Zeit lösen Videos über Polizeigewalt gegen Schwarze Menschen Debatten aus. Die Frage, die sich bei aller aufklärenden Absicht der Verbreitung solcher Bilder stellt, ist: Wo bleibt die Würde der Opfer? Auch die Akteure der Abolitionsbewegung im 19. Jahrhundert, also die AktivistInnen der Sklavenbefreiung, griffen auf Kupferstiche von gequälten Schwarzen Körpern zurück. Was steckt alles in solchen Darstellungen?
Versklavte Frauen wurden mit entblößtem Oberkörper ausgepeitscht, Männer mit nacktem Gesäß. Als Begründer der „Plantagenpornografie“ gilt der schottische Söldner John Gabriel Stedman, der von 1772 bis 1777 in Surinam an der Niederschlagung von Sklavenrebellionen beteiligt war. In seinem zwei Jahre später publiziertem „Reisebericht“ hat er seinen Schilderungen von exzessiven Auspeitschungen junger, nackter Sklavinnen einschlägige Kupferstiche von William Blake beigefügt. Im Wechselspiel von Bild und Text werden seine Leser dazu animiert, die Haut der gewaltsam entblößten Frauen selbst imaginär bis aufs blutige Fleisch auszupeitschen. Dieses Genre war relevant auch für die englische Abolitionsbewegung, die mit Druckgrafiken sexualisierter Auspeitschungsszenen die Gewalt- und Schaulust der europäischen Sklavenhalter vor Augen führte. Die AbolitionistInnen haben nicht so sehr die sexualisierte Gewalt im Namen der SklavInnen angeprangert als vielmehr die moralische Korruption der europäischen Sklavenhalter.
Und wenn wir jetzt zu den modernen Handy-Videos kommen?
Acht Minuten und 46 Sekunden hat die Tötung von George Floyd gedauert. Und er hat annähernd dreißig Mal gesagt, dass er nicht atmen könne. Wenn man sich damit als JournalistIn oder WissenschaftlerIn auseinandersetzt, muss man sich vor Augen führen: Wir haben es hier mit einem qualvollen Sterbeprozess zu tun. Müssen wir unsere Arbeit nicht auch als Trauerarbeit verstehen und uns fragen, welchen Gebrauch wir von den Handy-Videos machen? Sie stehen im Kontext der Gewaltgeschichte des Lynchens.
Für die Mitglieder der schwarzen US-Bürgerrechtsbewegung stand es außer Frage, dass die Lynchgewalt nach Abschaffung der Sklaverei „weiße Vorherrschaft“ wiederherstellen sollte und Lynchfotografien dabei eine zentrale Rolle spielten: Im pornografischen Genuss der rassistischen Verbrechen war die weiße Täter- und Zuschauergemeinschaft noch in der „schrecklichen Intimität“ ihres Zuhauses miteinander vereint. Dagegen richteten sich die Bildpolitiken der Bürgerrechtsbewegung. Ida B. Wells-Barnett etwa hat Lynchfotografien erstmals als Beweise gegen die Täter und Zuschauer selbst gerichtet. Auch die Handy-Videos sind Beweise für die Tötung George Floyds, sie zeigen Täter, Zeugen, Filmende.
Können wir verhindern, zu Komplizen wider Willen gemacht zu werden, wenn die Handy-Videos in Dauerschleife gezeigt werden? Ich denke, es ist vor allem George Floyds eigene Stimme, die das verhindert. Er hat mit seiner Stimme um sein Leben gekämpft und darum zu atmen. Er hat mit seiner Stimme eine internationale Black-Lives-Matter-Bewegung ins Leben gerufen, die seine Stimme politisch weiterträgt.
Wozu dient genau der ungewöhnliche Begriff „Undienlichkeit“ im Titel Ihres Buchs?
Ich wollte Gewaltgeschichte aus der Perspektive derer schreiben, die sie erlitten und ihr widerstanden haben. In Gewalträumen erscheint Widerstand unmöglich. Und doch haben Menschen immer wieder das Unmögliche getan und sich mit body politics, Hungerstreik, Abtreibung, Selbstverstümmelung, Freitod, Flucht undienlich gemacht. Aktiver und passiver Widerstand kann nicht am Erfolg gemessen werden, sondern nur daran, dass er überhaupt stattgefunden, dass er die absolute Gewalt der Täter, und sei es auch nur für einen Augenblick, irritiert, geschwächt und geteilt hat. Diese niedrigschwelligen Widerstandsereignisse habe ich sichtbar machen wollen, damit die Gewalt nicht das letzte Wort hat.
Iris Därmann: „Undienlichkeit. Gewaltgeschichte und politische Philosophie“. 510 Seiten, Matthes & Seitz, Berlin 2020. 38 Euro
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






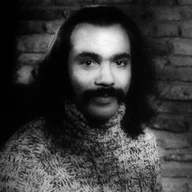
meistkommentiert
Israel, Nan Goldin und die Linke
Politische Spiritualität?
Matheleistungen an Grundschulen
Ein Viertel kann nicht richtig rechnen
Nikotinbeutel Snus
Wie ein Pflaster – aber mit Style
Innenminister zur Migrationspolitik
Härter, immer härter
Prozess gegen Letzte Generation
Wie die Hoffnung auf Klimaschutz stirbt
Börsen-Rekordhoch
Der DAX ist nicht alles