Kasse zahlt Downsyndrom-Bluttests: Gewollt ist nur die Norm
Pränatale Bluttests auf Downsyndrom werden bald die Regel sein. Das Signal ist klar: Wer anders ist, passt nicht in unsere Welt.

K rankenkassen sollen künftig Bluttests auf Downsyndrom bezahlen. Die Folgen sind klar: Es werden weniger Kinder mit Trisomie 21 zur Welt kommen. In Dänemark, wo seit 2005 allen Schwangeren eine Risikoabschätzung auf Downsyndrom angeboten wird, hat sich die Zahl der damit geborenen Kinder halbiert.
Zwar entschied der Gemeinsame Bundesausschuss, ein Gremium aus ÄrztInnen und VertreterInnen von Krankenkassen, dass der Test nur für Schwangere mit besonderem Risiko bezahlt werden soll. Derzeit ist er ab etwa 120 Euro privat erhältlich, die Nachfrage steigt. Doch die Risikodefinition ist nun so vage gehalten, dass ihn jede Schwangere bekommen kann, die sich Sorgen macht. Der Test dürfte zur Regel werden.
Das Gremium entscheidet nach medizinischen, nicht nach ethischen Kritierien. Waren Fruchtwasseruntersuchungen mit dem Risiko einer Fehlgeburt behaftet, ist der Bluttest risikolos – in der Logik des Systems ist die Entscheidung nachvollziehbar. Doch manchmal geraten Systeme an ihre Grenzen. Hier liegen sie darin, dass der Test keine mögliche Erkrankung prognostiziert, sondern eine Abweichung von der Norm sichtbar macht.
Weder die Gesundheit der Schwangeren noch des Kindes kann durch ihn verbessert, nichts kann geheilt werden. Deswegen kocht die Debatte nun hoch. Es wird mehr verhandelt als die Finanzierung eines Tests auf Trisomie 21. Die Frage ist: in welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Wie gehen wir damit um?
Soll ein Kind mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zur Welt kommen? Oder eines mit veränderten Geschlechtschromosomen, also etwa Klinefelter- oder Turner-Syndrom, deren TrägerInnen zum Teil nicht einmal wissen, dass sie betroffen sind? Soll ein Embryo mit Diabetes ausgetragen werden? Oder einer, dessen Genom Hinweise darauf gibt, dass später Probleme mit der Immunabwehr wahrscheinlich sind?
Der Test auf Trisomie 21 ist nicht das Ende der Entwicklung, sondern der Anfang. Das Genom eines Embryos kann heute vollständig analysiert werden. Schon jetzt sind Bluttests für einige der genannten Syndrome und Auffälligkeiten auf dem Markt. In den nächsten Jahren werden mehr Tests kommen. Die mögliche Erkenntnis, die mit ihnen gewonnen werden kann, ist so grenzenlos, wie sie überfordern kann. Wie gehen wir damit um?
Die Abbruchraten sind hoch
Die Abbruchraten, wenn derlei Abweichungen von der Norm festgestellt werden, sind hoch. Bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, umgangssprachlich als Hasenscharte bekannt, liegen sie laut einer Zusammenfassung von Studien aus mehreren Ländern bei mehr als der Hälfte.
Es mag paradox klingen, für das uneingeschränkte Recht auf Schwangerschaftsabbrüche einzutreten und trotzdem gegen die Einführung solcher Tests als Kassenleistung zu argumentieren. Aber das Problem ist nicht die Entscheidung, die eine Frau trifft, sondern die Gesellschaft, die Kinder mit Beeinträchtigungen diskriminiert.
Auf dem Rücken von Schwangeren
Das Signal, das vom krankenkassenfinanzierten Test auf Trisomie 21 ausgeht, ist deutlich: erwünscht ist, was der Norm entspricht, perfektioniert nach Kriterien der Leistungsgesellschaft. Wer anders ist, passt nicht in unsere Welt.
Das Spektrum dessen, was wir als gesund und lebenswert verstehen, verengt sich. Der Druck, den Test zu machen, wird steigen, und nach der Diagnose muss entschieden werden. Auf dem Rücken von Schwangeren wird ausgetragen, was gesellschaftlich debattiert werden sollte.
Wie weit wollen wir gehen?
Der politische Prozess immerhin, sich mit den Bluttests auseinander zu setzen, hat im April begonnen, als eine interfraktionelle Gruppe den Bundestag fragte: „Wie weit wollen wir gehen?“ Angeboten werden soll der Test auf Trisomie 21 ab Herbst 2020.
Wie sich ein gesetzgeberisches Verfahren bis dahin entwickelt, ist momentan nicht absehbar. Möglich wäre von Verboten bis zu einer Liberalisierung alles. Derzeit geht der Trend dahin, Menschen zu optimieren. Aber das Ziel sollte sein, die Bedingungen zu optimieren, unter denen wir leben.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







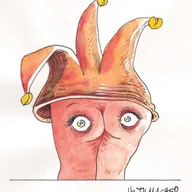

meistkommentiert
Stand der Koalitionsverhandlungen
Bitterer Vorgeschmack
Rechte Codes und Chiffren
So erkennst du rechte Sprache
Angriff auf Informationsfreiheit
Amthors Rache
Trump-Zölle auf Autos
Als Antwort einfach mal X abstellen
Die Deutschen Bahn in der Krise
Wie der Staatskonzern wieder fit wird
Illegales Autorennen in Ludwigsburg
Männer mit Mercedes im Kopf