Flüchtlingspolitik in Litauen: Gegen das Völkerrecht
Litauen erlaubt illegale Pushbacks von Migranten an der Grenze zu Belarus. Auch Patrouillen von freiwilligen „Grenzschützern“ sollen möglich werden.

Aber nur wenige Stunden später stimmte das litauische Parlament per Schnellverfahren für das exakte Gegenteil: Das am Donnerstag in Vilnius angenommene „Gesetz zur Staatsgrenze und deren Schutz“ erlaubt ausdrücklich sogenannte „summarische Rückführungen“ nach Belarus – ohne vorherige Asylprüfung. Dies „verankert die anhaltende Praxis der Pushbacks an der Grenze im litauischen Recht“, sagte Sophie Scheytt von Amnesty Deutschland.
Das Völkerrecht verbietet solche Pushbacks, also Sammelabschiebungen und Abschiebungen in Länder, in denen Menschenrechtsverletzungen drohen. Spanien, Griechenland, Kroatien, Lettland, Polen, Litauen und andere Länder setzen sich jedoch über dieses Verbot hinweg.
Besonders brisant ist, dass Litauen auch den Einsatz sogenannter „Paten“ beim Grenzschutz erlaubt. Hierbei handelt es sich um Freiwillige, die patrouillieren und Maßnahmen gegen Migranten und Asylbewerber ausüben dürfen – etwa bei Verhaftungen helfen. „Es gibt dabei keine Beschränkung für Menschen aus dem Ausland“, sagt Emilija Švobaitė, eine Anwältin und Aktivistin der NGO Sienos Grupė, dem Portal Euobserver. Auf dieser Grundlage könnten etwa Rechtsextreme aus Deutschland neben den nationalen litauischen Grenzschützern patrouillieren. Solche Patrouillen hatte es etwa auf dem Balkan in der Vergangenheit immer wieder gegeben – dort allerdings illegal.
Hilfe könnte kriminalisiert werden
Am 7. April 2023 war die Leiche eines mutmaßlichen indischen Migranten an der litauischen Grenze gefunden worden, im August 2022 die Leiche eines Mannes aus Sri Lanka. Im Oktober 2022 war bekannt geworden, dass Menschen in Litauen „aufgrund von Verletzungen an der Grenze Gliedmaßen amputiert werden mussten“, heißt es in einem offenen Brief vom Dienstag an das litauische Parlament, den rund 130 Jurist:innen und NGOs unterschrieben haben. Die Legalisierung der Pushbacks und die Einschränkung der humanitären Hilfe an der Grenze dürfte nach ihrer Einschätzung zu einer „erheblichen Zunahme solcher Fälle von Tod und Leid führen, verbunden mit der Kriminalisierung der Hilfe.“
Erst kürzlich hatte Litauen von Belarus wegen der Ankünfte der Asylsuchenden Entschädigung in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro verlangt. Belarus steuere die Einwanderung Tausender Menschen vor allem aus Afrika und dem Nahen Osten, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums.
Justizministerin Ewelina Dobrowolska sagte, die von Belarus gesteuerte Einwanderung laufe nicht über eine „natürliche“ Migrationsroute. Mit den 120 Millionen Euro sollten die Kosten gedeckt werden, die Litauen durch die Zurückweisung von Migranten und verstärkte Grenzkontrollen entstanden seien.
Stacheldraht, Inhaftierungen und Folter
Seit Mitte 2021 hat das Land insgesamt 20.000 Migranten, die über Belarus kamen, die Einreise verweigert. Inzwischen hat Litauen einen Stacheldrahtzaun entlang seiner 679 Kilometer langen Grenze zu Belarus errichtet.
Erst kürzlich hatte der Europarat in einem Bericht festgestellt, dass Länder wie Litauen mit ihrem Vorgehen gegen Schutzsuchende an der Grenze Praktiken angewendet haben, die den Tatbestand der Folter erfüllen. Menschenrechtsorganisationen weisen seit langem auf die Rechtsverletzungen von Migrant:innen in Litauen hin.
Im Mai 2022 berichtete Ärzte ohne Grenzen, dass rund 2.500 Menschen zu jener Zeit bereits neun Monaten unter menschenunwürdigen Bedingungen in Haft waren. Sie waren über Belarus eingereist. Kurz darauf hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg diese Internierung für rechtswidrig erklärt.
Eine Koalition, die was bewegt: taz.de und ihre Leser:innen
Unsere Community ermöglicht den freien Zugang für alle. Dies unterscheidet uns von anderen Nachrichtenseiten. Wir begreifen Journalismus nicht nur als Produkt, sondern auch als öffentliches Gut. Unsere Artikel sollen möglichst vielen Menschen zugutekommen. Mit unserer Berichterstattung versuchen wir das zu tun, was wir können: guten, engagierten Journalismus. Alle Schwerpunkte, Berichte und Hintergründe stellen wir dabei frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade jetzt müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Was uns noch unterscheidet: Unsere Leser:innen. Sie müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Es wäre ein schönes Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





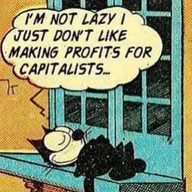
meistkommentiert
Alles zur Bundestagswahl
FDP-Chef Lindner verabschiedet sich aus der Politik
Sauerland als Wahlwerbung
Seine Heimat
Pragmatismus in der Krise
Fatalismus ist keine Option
Erstwähler:innen und Klimakrise
Worauf es für die Jugend bei der Bundestagswahl ankommt
Totalausfall von Friedrich Merz
Scharfe Kritik an „Judenfahne“-Äußerungen
Russlands Angriffskrieg in der Ukraine
„Wir sind nur kleine Leute“