Bau einer TSMC-Fabrik bei Dresden: Silizium-Schutzschild mit Löchern
Auf den ersten Blick ist die Mikrochip-Fabrik von TSMC in Sachsen ein Coup. Aber für Taiwan ist die Diversifizierung eine gefährliche Strategie.
F ür den Wirtschaftsstandort in Sachsen ist der Bau des TSMC-Werks zweifelsohne ein Grund zum Feiern, doch in Taiwan, der Heimat des Mikrochip-Giganten, ist das Thema in den Tageszeitungen bestenfalls nur eine Randnotiz. In ihrem Alltag sind die 23 Millionen Inselbewohner mit ganz anderen Themen beschäftigt; und überhaupt ist die Fabrik in Ostdeutschland nur eine von vielen: TSMC expandiert in die USA, nach Japan und auch nach China.
Auf den ersten Blick ist die deutsch-taiwanische Wirtschaftskooperation eine klassische Win-win-Situation: Die Bundesregierung kann kurz vor den Landtagswahlen ein Zeichen setzen, dass sie die ostdeutschen Bundesländer nicht vergessen hat – das ist ihr in diesem Fall auch 5 Milliarden Euro an Subventionen wert.
Und TSMC kann seine Präsenz auf dem europäischen Markt ausweiten und neue Fachkräfte anwerben. Zudem hat der Deal auch eine Signalwirkung: Taiwan präsentiert sich als attraktiver Handelspartner – und wirbt damit auch politisch um jene Solidarität, die es so dringend benötigt.
Ein zweischneidiges Schwert
Dennoch ist die Diversifizierung von TSMC auf lange Sicht ein zweischneidiges Schwert. Um das zu verstehen, muss man die Theorie des „Silizium-Schutzschildes“ kennen: Nicht wenige Experten gehen davon aus, dass Taiwan vor allem aufgrund seiner krassen Marktdominanz bei hochkomplexen Halbleitern eine wirtschaftliche Abhängigkeit geschaffen hat, welche auch abschreckend auf die chinesische Volksbefreiungsarmee wirkt. Peking hat weniger Anreize, Taiwan einzunehmen, weil eine Invasion der eigenen Wirtschaft immens schaden würde.
Je mehr allerdings TSMC seine Produktion in andere Länder verlagert, ja aufgrund des internationalen Drucks verlagern muss, desto löchriger wird der unsichtbare Schutzschild Taiwans. Der Inselstaat muss also allein schon aus Eigeninteresse jene Abhängigkeit aufrechterhalten, die der Westen aus ökonomischem Interesse vermeiden möchte. Anders ausgedrückt: Die Kosten, die China für einen Krieg zahlen müsste, würden mit jeder weiteren Fabrik im Ausland sinken.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






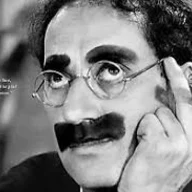


meistkommentiert