Archäologin über Nahrungsmitteltabus: „Haushuhn als neue Eiweißquelle“
Die einen essen kein Schwein, die anderen keine Würmer: Nahrungsmitteltabus haben ganz unterschiedliche Ursachen, erklärt Eva Rosenstock.

taz: Gab es bereits in der Steinzeit Nahrungstabus?
Eva Rosenstock: Es gibt immer wieder Fälle, wo man sich fragt, warum verschwindet dieses oder jenes archäologische Fundmaterial, das auf ein Lebensmittel hindeutet? Unser Grabungsteam hat in Çatalhöyük in Anatolien für die Zeit nach 6.000 vor Christus, also die Jungsteinzeit, Hinweise auf Ziegen und Schafe als Nahrungsmittel gefunden, aber kaum Rinder. Vorher, im 7. Jahrtausend vor Christus, ist das Rind an diesem Fundplatz jedoch belegt. Vielleicht war es nicht wirtschaftlich? Oder entwickelte sich ein Tabu? Das kann man schwer sagen.
Anscheinend gibt es keine Belege für Insektenverzehr in Europa in der Vorzeit.
Das muss aber nicht bedeuten, dass Insekten nicht verzehrt wurden. Interessanterweise wurden archäologische Fundstätten in Europa bislang kaum auf Chitinreste hin untersucht. Erklärungsmöglichkeiten bietet hier wiederum das Alte Testament. Es schreibt vor, keine landlebenden Insekten oder Würmer, mit der Ausnahme von Heuschrecken, zu essen.
Ein Kennzeichen des Christentums war es jedoch, dass es die jüdischen Speisevorschriften nicht übernahm. Ob die christlich-europäische Abscheu vor Landinsekten trotzdem indirekt aus der Bibel oder aus der Zeit vor der Christianisierung etwa von den Römern oder gar noch aus älterer Zeit stammt, ist allerdings schwer zu sagen. Insektenverzehr ist für christliche Europäer zwar unüblich aber kein Tabu: Rezepte für Maikäfersuppe sind in Deutschland durchaus überliefert.
Oft werden hygienische Gründe hinter Nahrungstabus vermutet. Essen darum Muslime und Juden kein Schweinefleisch?
Im 3. Buch Moses steht: Du darfst alles essen, was Paarhufer ist und wiederkäut. Das Schwein gilt vielleicht als „unrein“, weil es als Paarhufer, der jedoch nicht wiederkäut, aus dem Kanon von Schaf, Ziege und Rind herausfällt. Und ab dem ersten Jahrtausend v. Chr. fehlen in der Tat Schweineknochen in etlichen archäologischen Fundkontexten im Vorderen Orient; vorher ist es allerdings gang und gäbe, Schweinfleisch zu verzehren, sodass Trichinen, also parasitische Fadenwürmer und damit die Hygiene-Theorie als Erklärung für das Speisetabu nicht wirklich stichhaltig sind.
Das Tabu tritt auch erst auf, als sich das Haushuhn als neue Eiweißquelle ausbreitete: Vielleicht konnte man ab da also ohne Schwein auskommen – das wären dann eher ökonomische Gründe.
Fungieren Tabus auch als sozialer Kitt?
Ja, das ist eine sehr wichtige Funktion. Sie stärken den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, bestimmen die eigene Identität und schaffen Abgrenzung von anderen Gruppen. So ist das katholische Fasten und damit „Fleischtabu“ am Freitag nur gesellschaftlich-religiös zu erklären.
Die Archäologin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Prähistorische Archäologien der Freien Universität Berlin. Sie leitet dort seit 2011 die Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe „Lebensbedingungen und biologischer Lebensstandard in der Vorgeschichte“.
Gibt es auch Pflanzentabus?
Nur sehr, sehr selten. Für Schwangere sind jedoch ethnografische Pflanzentabus bekannt, und wir wissen, dass der höchste Jupiter-Priester in der Antike Bohnen weder anfassen noch essen durfte. Damals gedieh in Europa Vicia faba, die Ackerbohne; heutige Phaseolus-Bohnen stammen aus Amerika und sind viel besser verträglich, weil ihr Alkaloid-Gehalt niedriger ist. Bei manchen Menschen führte der Verzehr der Ackerbohne zu Favismus, einer schweren Stoffwechselstörung. Darum könnte das Tabu gegolten haben. Aber vielleicht war die Bohne auch nur ein Symbol für etwas, das wir heute nicht kennen.
Warum sind Pflanzentabus so selten?
Die Pflanzenwelt ist schon mit vielen Regeln belegt, weil es sehr viele unverträgliche bis giftige Varianten gibt, etwa ungekochte Hülsenfrüchte, Knollenblätterpilze oder Tollkirschen. Fleisch ist hingegen universell verträglich. Wenn man einmal ein Säugetier ausgenommen hat, dann kann man das unabhängig von der genauen Tierart. Und man kann es gefahrlos verzehren.
Zudem stellt schon der Verzehr von geringen Mengen Fleisch mit seinem hochwertigen Eiweiß sicher, dass der Bedarf an Aminosäuren gedeckt ist. Andererseits lösen tierische Lebensmittel leichter Ekel aus als pflanzliche – dahinter könnte ein kultureller oder biologischer Mechanismus zum Schutz vor Krankheitserregern stecken.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






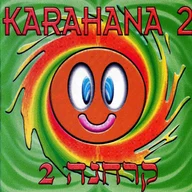

meistkommentiert