Feier des Jerusalemtages: Zwischen Gewalt und Blumen
In Jerusalem feiern viele Israelis die Vereinigung der Stadt, das geht auch mit Rassismus gegen Palästinenser einher.

An diesem Montag zieht auch der rechtsextreme Sicherheitsminister Israels, Itamar Ben-Gvir, durch die Altstadt. Mit einer großen Gruppe hat er gemeinsam auf dem Tempelberg gebetet: Bis vor etwa zweitausend Jahren stand dort der zweite jüdische Tempel, heute aber die Al-Aqsa-Moschee.
Eigentlich ist es ausschließlich Musliminnen und Muslimen gestattet, dort zu beten – doch seit Jahren wird immer wieder ganz bewusst der Status quo missachtet. Einige der radikalen Israelis, die den Jerusalemtag begehen, wollen die Al-Aqsa-Moschee abreißen und den jüdischen Tempel dort wieder aufbauen, mit Stickern und Sprüchen zeigen sie ihre Haltung.
Angst vor Übergriffen
Aus Furcht vor Übergriffen sind schon am Morgen des Jerusalemtages die meisten Geschäfte von Palästinensern und Palästinenserinnen in der Altstadt geschlossen. Nur wenige versuchen noch, ihre Ware an Mann und Frau zu bringen. Khaled, der nur seinen Vornamen nennt, betreibt seit vielen Jahren einen kleinen Laden für Kleidung in der Altstadt: „Ich bin nur hier, um zu schauen, ob Leute ihre Geschäfte geöffnet haben. Besser wäre es, wenn viele da wären“, sagt er. Aber er könne verstehen, dass die meisten gar nicht erst öffnen: „Sie haben Familie und Angst vor dem Verlauf des Tages.“
Einige israelische Friedensaktivisten und -aktivistinnen sind angereist. Manche von ihnen kaufen am Morgen als Geste ganz bewusst in palästinensischen Läden ein. Doch in wenigen Stunden wird auch der letzte Palästinenser gezwungen sein, seinen Rollladen herunterzulassen und nach Hause zu gehen. Die Aktivisten und Aktivistinnen sind in einer Friedensmission unterwegs. Manche verteilen Blumen als Zeichen der Solidarität, andere stellen sich schützend vor Hauseingänge, hinter denen palästinensische Familien wohnen.
Palästinenser verlassen vorsichtshalber die Altstadt
Einige palästinensische Familien verlassen vorsorglich die Altstadt, um nicht Opfer von Übergriffen und Gewalt zu werden. Denn der Flaggenmarsch der Jerusalemtag-Feiernden zieht am Nachmittag direkt durch das muslimische Viertel zur Klagemauer, dem Fuß des Tempelbergs. Und auf die israelischen Sicherheitskräfte könne man sich nicht verlassen, sagt Khaled.
Auf Krawall gebürstete jüdische Jugendliche ziehen schon am Vormittag durchs das Viertel, singen laut religiöse Lieder und tanzen auf der Straße. Eine heitere Stimmung – wäre nicht die aggressive Grundhaltung. Die Teenager spucken provozierend vor noch geöffnete Läden von Palästinensern, aber auch vor die Füße von Friedensaktivistinnen und -aktivisten und Journalistinnen und Journalisten.
Israelische Aktivisten wollen deeskalieren
Israelis der Gruppe „Standing Together“ sind schon früh in die Altstadt gekommen, um solche Übergriffe zu dokumentieren und in angespannten Situationen zu deeskalieren. Nicht alle von ihnen tragen die lila Westen ihrer Gruppe, weil sie dadurch selbst zur Zielscheibe würden.
Sahar, Aktivist
Am Vormittag schickt die Polizei die radikalen Jugendlichen noch weg und verhaftet einzelne, die über die Stränge schlagen – oder die Autorität der zumeist drusischen, arabischsprachigen Polizisten nicht anerkennen. Aber die Aktivisten von „Standing together“ wissen: Die Sicherheitskräfte kommen eher zu Hilfe, wenn auch israelische Menschen betroffen sind.
Die Aktivistinnen und Aktivisten patrouillieren immer mindestens zu dritt. Einer von ihnen ist Sahar: „Ich persönlich bin auch bereit, physische Gewalt einzustecken. Hier in unserer kleinen Gruppe stehe ich deswegen dann vorne.“ Da er letztes Jahr schon Übergriffe erlebt hat, trägt er dieses Jahr zur Dokumentation eine Kamera am Körper.
Israelische Sicherheitskräfte gegen Aktivisten
Doch später am Tag vertreiben die israelischen Sicherheitskräfte die letzten verbliebenen Aktivistinnen und Aktivisten aus der Altstadt. Dann kann die palästinensische Bevölkerung dort nur noch auf die israelischen Sicherheitskräfte hoffen. Vor einer Haustür, die am Mittag noch von Aktivisten beschützt wurde, stehen nun zwei drusische Polizisten. Bis sie ein paar Meter weiter laufen – um ein paar Jugendliche aus einem Hauseingang zu zerren, in den sie gerade einbrechen konnten.
Nicht alle suchen Ärger: Viele sind gekommen, um einen fröhlichen Tag zu feiern. Denn mit dem Ende der jordanischen Besatzung 1967 kam die Klagemauer das erste Mal seit fast zweitausend Jahren wieder unter jüdische Kontrolle. Jüdinnen und Juden können nun jederzeit an der westlichen Umfassungsmauer des letzten Tempels –alles, was vom zweiten Tempel und damit dem Allerheiligsten im Judentum noch übrig ist – beten.
An der Klagemauer wird gesungen und getanzt – so etwa von der jungen Liad mit ihren Freundinnen. Sie laufen ausgelassen durch die Menge vor der Klagemauer. Die Menschen singen – über Gott und Freude über das Leben des jüdischen Volkes.
Doch in diesem fröhlichen, vereinten Jerusalem scheint nur für eine ganz bestimmte Gruppe Platz.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





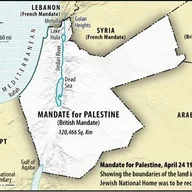

meistkommentiert
ACAB-Debatte der Grünen
Jette Nietzard will Grüne bleiben
Virologe Hendrick Streeck ist zurück
Warum nicht auch Drogenbeauftragter?
Preisvergabe an Ursula von der Leyen
Trump for Karlspreis!
Hessische Ausländerbehörden
Arbeit faktisch eingestellt
Deutsche Waffen in der Ukraine
SPD gegen geplante Aufhebung der Reichweitenbeschränkung
Unvereinbarkeitsbeschluss der Union
Überholter Symmetriezwang