Rassismus am Theater: Die Kinder Louvertures
Das Düsseldorfer Schauspielhaus steht für seinen Umgang mit Rassismusvorwürfen in der Kritik. Es ist auch ein Konflikt zwischen jungen Aktivisten und Theatergranden.
A ls in den vergangenen Monaten auf den Bühnen des Theaters nicht viel los war, wurde mehr als je zuvor darüber geredet, was hinter den Kulissen so passiert. So steht das Düsseldorfer Schauspielhaus zur Zeit im Zentrum einer hitzigen Debatte über Rassismus und Machtmissbrauch, ausgelöst von einer am 18. März ausgestrahlten TV-Doku des WDR, in der der Schwarze Schauspieler Ron Iyamu von rassistischen Erlebnissen berichtet, die ihm an dem Theater widerfahren sein sollen.
Ron Iyamu – 29 Jahre alt, festes Ensemblemitglied am Haus – erhebt schwere Vorwürfe: Man habe ihn stereotyp besetzt, beleidigt und beschimpft und es habe einen rassistischen Übergriff gegeben, der später als Vorfall mit dem Cuttermesser die Runde macht: Ein Schauspielkollege soll ihm nach einer Probe von „Dantons Tod“ ein solches Werkzeug an den Schritt gehalten und gesagt haben: „Wann schneiden wir dem N-Wort eigentlich die Eier ab?“ Doch: „Es gab nie Konsequenzen“, sagte Iyamu – obwohl er die zuständigen Personen zeitnah informiert habe.
Die nächste Sequenz in der TV-Doku zeigt den Intendanten des Schauspielhauses Wilfried Schulz. Man sieht dem 69-Jährigen an, wie unangenehm ihm dieser Auftritt ist. Er lächelt beschämt, sagt: „Mea culpa“.
Wahrscheinlich wäre die Sache noch vor ein paar Jahren damit erledigt gewesen. Sie wäre vermutlich gar nicht erst an die Öffentlichkeit gekommen. Was hinter den Kulissen eines Theaters passierte, blieb normalerweise dort. Die Probe galt als geschützter Raum, nichts drang nach außen, es sei denn, der Regisseur äußerte sich selbst dazu. Schauspieler:innen hingegen schwiegen, schon alleine aus Angst davor, nicht mehr besetzt zu werden. Doch spätestens mit MeToo und Black Lives Matter ist der Umgang mit Diskriminierung ein anderer geworden.
Zugleich ist auch die Sensibilisierung größer geworden. Viele Dinge, die früher vielleicht stillschweigend hingenommen worden wären, werden heute als grenzüberschreitend erlebt und dementsprechend geahndet.
So brechen nach dem Fernsehbeitrag von Iyamu die Schwarze Theatermacherin Natasha A. Kelly und 21 weitere Künstler:innen die Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus ab, fordern ihr Honorar und eine eigene selbstorganisierte Bühne für Schwarze Menschen und People of Color. Ihre Petition haben bereits mehr als 25.500 Menschen unterschrieben.
Der Dramaturg Bernd Stegemann veröffentlicht einen Beitrag in der FAZ, in dem er sich kritisch zu Identitätspolitik und ihre angebliche Bedrohung für die Kunstfreiheit äußert. Ron Iyamu bezeichnet er darin als „unsicheren jungen Mann“, „der im schauspielerischen Ausdruck blockiert“ sei und sich „in den Selbstschutz der empörten Kränkung begeben“ habe.
Drei Tage später veröffentlicht eine Gruppe Theaterschaffender um den Theatermanagement-Professor und Machtmissbrauchs-Forscher Thomas Schmidt einen offenen Brief, in dem sie den Dramaturgen zu einer Entschuldigung auffordert. Diesen Brief unterzeichnen über 1.400 Menschen, darunter namhafte Theatermacher:innen. Einige andere berichten in der Folge in den sozialen Netzwerken von ihren eigenen Rassismuserfahrungen am Theater.
Dantons Tod
Iyamus Gang an die Öffentlichkeit hat eine Revolution ausgelöst: Wo junge, diverse, feministische Theaterkünstler:innen auf der einen Seite stehen und etablierte, oftmals weiße Entscheider:innen auf der anderen.
Wie kam es so weit?
Ron Iyamu erhält 2019 ein Engagement am Düsseldorfer Schauspielhaus. Es läuft gut für ihn, gleich zwei große Regisseure wollen mit ihm arbeiten. Einer von ihnen ist Armin Petras, früher Intendant am Maxim Gorki Theater in Berlin und am Schauspiel Stuttgart, heute freier Regisseur und Stückeschreiber. Er möchte Iyamu in „Dantons Tod“ besetzen, mit dem die neue Spielzeit 2019/20 eröffnet werden soll.
„Ich habe mich riesig auf die Probenzeit gefreut, aber dann wurde es sehr skurril für mich“, sagt Iyamu bei einem Videogespräch mit der taz Ende April. Er sieht erschöpft aus. Er komme kaum zur Ruhe. Schon allein deshalb, weil ihn seither ständig neue Erfahrungsberichte über Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Mobbing erreichen würden. Auch sein eigener Konflikt mit dem Haus sei noch nicht vorbei. „Ich ziehe gefühlt seit fünf Wochen an einer Schnur und es kommt immer mehr Scheiße zum Vorschein.“
Auch in seiner Diplomarbeit setzt sich Iyamu mit Rassismuserfahrungen in der deutschen Schauspielszene auseinander. Dass ihn ausgerechnet die Probenzeit mit Armin Petras in eine tiefe Krise stürzte, irritiert. Petras, 57 Jahre alt, ist kein konservativer Regisseur, sondern links, politisch interessiert, gesellschaftskritisch. Im Gespräch mit der taz erzählt er, was ihn an Georg Büchners Revolutionsdrama „Dantons Tod“ interessiert hat: „Ich wollte etwas über Revolution heute erzählen.“ Bei seinen Recherchen fiel ihm auf, dass zur Zeit der Französischen Revolution auch Schwarze Menschen und Frauen für ihre Rechte gekämpft hatten. Also baute er einen haitianischen Freiheitskämpfer und eine Frauenrechtlerin mit ein. Den müden Revolutionär Danton besetzte er mit einem älteren weißen Mann und seinen Kontrahenten, den viel radikaleren Robespierre, mit einer jungen Frau.
„Ich wollte damit einen Link zur heutigen Zeit setzen, weil diejenigen, die sich gerade mehr Platz in der Gesellschaft erobern, auch Frauen sind.“ Ihn habe die Auseinandersetzung mit der jüngeren Generation, ihr Blick auf das Leben und das Theater gereizt. Deshalb engagierte er Schauspielabsolvent:innen und viele Studierende.
Die Proben seien vielversprechend losgegangen, sagt Anna-Sophie Friedmann, Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus, die an den Proben teilnahm. Es beeindruckte sie, wie sehr Petras alle bei der Stückentwicklung mit einbezog. „Damals fand ich das cool, weil ich dachte, wir werden als eigenständige Künstler:innen ernst genommen, aber dafür hätten wir auch mit Respekt behandelt werden müssen und das ist nicht passiert.“
Die Produktion sei extrem anstrengend gewesen, sagt Anna-Sophie Friedmann. Armin Petras habe sie angeschrien, fand nicht gut, dass sie eine gefährliche Menschenpyramide abgebrochen hatte und habe sie dann mit einer Rolle besetzt, in der sie kaum noch zu erkennen war. Petras habe in den letzten drei Probenwochen oft gebrüllt, sagt auch Iyamu. Sein Lieblingskommando: „Schneller, lauter, heiterer, ihr Penner!“
In dieser Gemengelage sei es immer wieder zu Rassismus gekommen, sagt Iyamu. So hätten einige seiner weißen Schauspielkolleg:innen darstellen wollen, wie in Paris das Ende der Sklaverei gefeiert wurde. Auf der Bühne ließen sie sich von einem ihrer Mitstreiter zum Tanz anleiten, während ein anderer „I have a Dream“ von Martin Luther King rief.
Er habe kurz darüber nachgedacht, ob er die Szene abbrechen oder spielerisch mit ihr umgehen solle. „Ich bin dann auf die Bühne und Armin fängt an, Regieanweisungen zu geben, so nach dem Motto ‚Könnt ihr vielleicht noch afrikanischer tanzen?‘ – und die anderen so: ‚Klar, können wir‘.“ Und dann hätten sie alles ausgepackt, was sie an Klischees von afrikanischen Tänzen im Kopf hatten, sagt Iyamu. Petras habe gelacht und sie so angefeuert.
Dann habe Petras abgebrochen und gesagt, dass er sich wünsche, diese Szene genau so einzubauen mit Iyamu, wie er am Ende auf die Bühne kommt und sie dann alle mit einem Maschinengewehr erschießt. Seine Kolleg:innen hätten sich daraufhin total verwirrt angeguckt, sagt Iyamu. Die Szene wurde nie eingebaut.
In diesem Moment habe er gedacht, dass Petras erkannt habe, wie rassistisch die Szene war, sagt Iyamu. Dass der Regisseur seine Schauspielkolleg:innen aber so auflaufen ließ, indem er sie ermutigte, rassistische Stereotype zu reproduzieren, ist für Iyamu ein manipulativer Akt.
Die Improvisation sollte rassistische Vorstellungen kritisieren, antwortet Petras auf eine Nachfrage der taz. Aus heutiger Sicht finde er sie auch problematisch, da er eine „mögliche Traumatisierung oder Re-Traumatisierung“ von Rassismus betroffener Personen nicht bedacht habe. Iyamu sagt, Petras habe bei den Proben immer wieder rassistische Sprüche gemacht wie: „So schwarz bist du ja gar nicht, jetzt wärst du beinahe zwischen den anderen verschwunden.“ Ein anderes Mal soll er zu einem aus der Sommerpause wieder gekommenen Kollegen gesagt haben, jetzt sei er fast so dunkel wie Iyamu. Petras bestreitet das.
Bei einer Theaterprobe ist es üblich, dass Schauspieler:innen mit ihrem Rollennamen angesprochen werden. Petras hatte Iyamu gefragt, ob er sich vorstellen könne, den haitianischen Freiheitskämpfer Toussaint Louverture zu spielen. Ron Iyamu zögerte, ob er diesen Mann spielen wollte. Eigentlich war er die Reduzierung auf seine Hautfarbe leid. Andererseits war es eine gute Gelegenheit, die Geschichte eines Schwarzen Menschen auf die Bühne zu bringen, also sagte er zu.
Nachdem er Petras erzählt hatte, dass er auch rappt, entstand die Idee, ein Musikvideo zu dem Stück beizusteuern. Auf der Grundlage eines Textes von Heiner Müller, der von einem gescheiterten Sklavenaufstand handelt, schrieb Iyamu einen Text, der Rassismus dort anklagt, wo er ihn erfahren hat: im Theater.
Das Musikvideo zeigt, wie eine Gruppe junger Menschen durch einen dunklen Korridor streift, während Ron Iyamu über eine Erneuerung des hierarchischen Stadttheaters rappt:
„Wir sind die Kinder Louvertures / Es hallt durch Zuschauerräume / Wenn wir die Wahrheit schrei’n / Wir reißen Deutschlands marode Theater ein / Wir pressen die Wände und Grenzen hinaus / Zersetzen die Ketten der Ängste zu Staub / Zerfetzen die Bretter und Dämme für Raum / Verletzen die mächtigen Männer und Frau’n.“

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Petras hätten seine Lyrics gut gefallen, sagt Iyamu. Der Regisseur habe ihn danach sogar mehr respektiert, weil er ja selber schreibe, vermutet er. Das habe ihn aber nicht davon abgehalten, ihn „Sklave“ zu rufen.
Armin Petras, Regisseur
Das sei ganz klar ein Fehler gewesen, sagt Armin Petras am Telefon. „Ich habe mir den Figurennamen nicht merken können, weil ich kein Französisch kann, und sträflicherweise nicht etwa der ‚entflohene Sklave‘ gesagt. Ich habe mich dafür aber zweimal bei Ron entschuldigt, einmal direkt nach den Vorfällen während der Produktion und dann nochmal nach der Veröffentlichung der Vorwürfe per E-Mail, wo ich auch um ein klärendes Gespräch gebeten habe.“
Iyamu räumt ein, dass es in der Probenzeit ein Gespräch mit dem Regisseur gab, in dem er ihn darum bat, mit den Witzen aufzuhören, woraufhin dieser auch aufgehört habe. Kurz vor der Premiere seien sie auf Bitten von Petras dann noch einmal spazieren gewesen, wo Petras ihm gesagt habe, dass er über die Probenzeit, und was sie da so zu Rassismus besprochen hätten, nachgedacht habe und ein Lernprozess bei ihm eingetreten sei.
Dann ist da noch die Szene mit dem Cuttermesser, zu der es bis heute unterschiedliche Ansichten gibt. Der Schauspielkollege, dessen Name der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, und der Iyamu nach einem Videodreh mit einem Cuttermesser entgegengetreten sein soll, ist laut Anna-Sophie Friedmann und Ron Iyamu schon vorher mit sexistischen Sprüchen aufgefallen. Ob er in der Situation einfach wütend auf Iyamu war, weil sie zuvor eine Folterszene gespielt hatten, in der Iyamu der Henker und der Kollege sein Opfer gewesen war? „Vermutlich wollte er aus seiner Sicht bloß einen blöden Witz machen“, sagt Iyamu, trotzdem sei die Probe zu diesem Zeitpunkt vorbei gewesen.
Darüber, wie es danach weiterging, gehen die Darstellungen ebenfalls auseinander. Iyamu sagt, dass er den Diversitätsbeauftragten und die Dramaturgin darüber informiert und letztere darum gebeten habe, den Vorfall in der Produktion anzusprechen. Der Intendant sagt, dass es zwischen Iyamu und der Dramaturgin offenbar ein Missverständnis gegeben habe. Sie habe verstanden, dass sie den Vorfall weder in die Produktion zurücktragen noch der Leitung gegenüber ansprechen soll.
Deshalb habe er auch erst Monate später davon erfahren, sagt Intendant Wilfried Schulz im Gespräch mit der taz. Er habe den Fehler gemacht, danach nicht selbst mit Iyamu darüber gesprochen, sondern den Leiter des Jungen Schauspiels darum gebeten zu haben.
Iyamu sagt, dass er die Situation mit dem Cuttermesser auch Petras erzählt hat. Petras hingegen will davon nur als Gerücht von einer Mitarbeiterin des Theaters gehört haben, hält es aber durchaus für möglich, dass so was passiert sein könnte. So oder so fühle er sich schuldig. „Denn das heißt ja, dass bei uns auf der Probe eine Atmosphäre gewesen sein muss, wo zumindest ähnliche Dinge möglich gewesen sind – und das finde ich in Anbetracht des großen Leidensdrucks eines jungen Schwarzen Mannes problematisch.“
Petras kämpft gerade um seine Existenz. Er verstehe nicht, warum ausgerechnet er im Mittelpunkt einer Rassismusdebatte stehe, wo es viel problematischere Regisseure gebe. Trotzdem habe ihn diese Erfahrung zum Nachdenken gebracht. Er spricht von einer verschobenen Selbst- und Fremdwahrnehmung, von seiner Teilnahme an Workshops zu Critical Whiteness, und davon, dass er in seiner aktuellen Produktion am Schauspielhaus Hannover Rassismen, Diskriminierungen und problematische Darstellungsweisen mit seinem Ensemble permanent diskutiere.
„Wir setzen uns ja nicht erst seit gestern mit Diversität auseinander“, betont auch Intendant Schulz im Gespräch mit der taz. Schließlich beschäftige sein Haus seit 2019 zwei Mitarbeiter:innen für Diversitätsfragen, mache Programm für People of Color und Menschen mit Migrationsgeschichte und habe einen Safe Space für Schwarze Menschen.
Eine externe Beratungsfirma werde sich die Rassismusvorwürfe nochmal genau angucken. Außerdem arbeite sein Haus an einem Kodex, der diskriminierendes Verhalten verhindern solle. Und es sei noch eine Zukunfts-AG im Gespräch: „Ich finde es eine große und gute Herausforderung, über die Zukunft nachzudenken, und ein Teil davon zu sein, sie zu formulieren“, sagt Schulz in der taktierenden Sprache eines erfahrenen Theatermanagers.
„Nach Rons Veröffentlichung gab es eine Spaltung im Haus“, sagt eine Mitarbeiterin. „Manche sagen, es braucht neue Theaterstrukturen, andere wollen den Ruf ihres Hauses unbedingt schützen, und wieder andere finden grundsätzlich alles scheiße, was neu ist, und versuchen, das Alte zu erhalten.“
Wer ihnen vorwerfe, dass sie die Entscheidungsträger:innen entmachten wollten, um selber an die Macht zu kommen, liege falsch, sagt Sahar Rezaei, eine junge Theatermacherin. „Wir wollen ihren Platz nicht einnehmen, weil ihr System falsch ist.“
Sahar Rezaei kommt aus Teheran und studiert Regie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. 2020 war sie Gast-Regieassistentin am Düsseldorfer Schauspielhaus in Roger Vontobels Inszenierung von Franz Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“. Vontobel ist Hausregisseur des Schauspielhauses.
Vier Wochen nach Iyamus WDR-Beitrag hatte Sahar Rezaei auf Instagram von der Zusammenarbeit mit Vontobel berichtet – und sie erzählt es nochmal der taz. In dem Kafka-Monolog berichtet ein sprechender Affe davon, wie er nach Europa verschleppt wurde und eine Menschwerdung durchlaufen hat, um in die Gesellschaft hineinzupassen. „Wir haben zu Beginn der Proben über verschiedene Konzepte gesprochen und uns immer wieder gefragt, wer dieser Affe sein könnte“, erinnert Rezaei sich. „Und dann kam irgendwann die Idee auf, dass dieser Affe doch ein Afrikaner sein könne, der nach Europa kommt, und ich dachte, dass dies ein total falsches Bild ist und habe das gleich zu Anfang kritisiert.“
Daraufhin habe Vontobel gesagt: „Ja, aber wir sind ganz furchtbare Menschen, wir machen ganz schlimme Sachen, wir trinken viel – würdest du so wie wir sein wollen?“ Da sei ihr klar geworden, dass sie in dieser Produktion selbst wie der Affe betrachtet werde, sagt Rezaei. Ein Eindruck, der sich für sie durch die ständigen Fragen nach ihrer Herkunft noch verfestigte.
Auf Nachfrage der taz bedauert Roger Vontobel, dass Sahar Rezaei die dramaturgischen Betrachtungen zu dem Kafka-Monolog, in dem es seiner Auffassung nach um die gewaltsame Kolonialisierung und Zwangsassimilierung gehe, auf sich bezogen habe. „Das war weder Intention des gemeinsamen Diskurses im Team, noch entspricht diese Wahrnehmung meinen Aussagen und meinen eigenen Ansichten und Betrachtungen.“
Doch immer mehr junge Theaterschaffende haben keine Geduld mehr mit Menschen wie Vontobel, Armin Petras und Wilfried Schulz. Sie haben sich deren Art und Weise, mit internen Konflikten umzugehen, lange genug angesehen und finden ihren Sinneswandel befremdlich.
Es sind gut ausgebildete, vernetzte, politisch aktive und manchmal auch sehr aktivistische Menschen. Sie machen gerade ihren Abschluss, sind vor Kurzem in den Beruf eingestiegen oder arbeiten erst wenige Jahre in ihm. Sie kennen ihre Rechte und sie haben keine Lust mehr, in einem Arbeitskontext zu arbeiten, den sie als diskriminierend oder ungerecht empfinden. Sie sind die Theaterdynastien, wo jeder mit jedem befreundet ist, leid. Dabei finden sie Vontobel, Schulz oder Petras gar nicht mal schlimmer als andere. Ja, es gehe sogar noch viel schlimmer, sagen sie.
Auf der anderen Seite stehen die etablierten Theatermacher:innen, die sich einer schonungslosen Kritik ausgesetzt sehen. Die schockiert sie auch deshalb so, weil sie sich selbst als progressiv, sozialkritisch und antifaschistisch begreifen. Und weil sie ihr Handwerk zu einer Zeit gelernt haben, als man sich hochdiente, ohne aufzumucken, Theater von Männern gemacht wurde, die sich als allein Verantwortliche begriffen, dafür aber auch über ihr Personal verfügten, als wäre es ihr Eigentum, und Menschen mit Migrationsgeschichte, Schwarze Menschen und People of Color höchstens am Rand der Bühne standen, sodass sich die mehrheitlich weißen Theatermacher:innen mit ihren Perspektiven auch nicht wirklich auseinandersetzen mussten.
Diskursverschiebung
Inzwischen gibt es jedoch vermehrt Diskurse zu Gendergerechtigkeit, Postkolonialismus und Antirassismus, eine diverser werdende Theaterszene, Studien zum Machtmissbrauch an Theatern, brancheninterne Beratungsangebote wie Themis, Zusammenschlüsse wie das Ensemble Netzwerk und Künstler:innen-Kollektive wie Staub zu Glitzer – und Menschen wie Ron Iyamu, die ihre Erfahrungen öffentlich machen.
Eine Kettenreaktion tritt ein: 2018 der Fall Matthias Hartmann am Burgtheater in Wien, 2019 der Fall Volker Metzler am Theater an der Parkaue Berlin, 2020 der Fall Peter Spuhler am Badischen Staatstheater, 2021 der Fall Klaus Dörr an der Berliner Volksbühne, 2021 der Fall Shermin Langhoff am Maxim Gorki Theater in Berlin – außerdem Düsseldorf …
Im Moment wirkt Vieles wie ein ungesundes Kräftemessen, bei dem beide Seiten ihre Karrieren aufs Spiel setzen. Eines, das durch den pandemiebedingt lange stillgelegten Theaterbetrieb noch mal befördert worden ist. Denn immerhin hat man es hier ja auch mit Menschen zu tun, die die Aufmerksamkeit lieben. Ob jung oder etabliert – sie alle stehen gerne im Rampenlicht. Dabei wäre eine einander zugewandtere Debatte gerade dringend nötig, damit das Stadttheater trotz geringer Zuschauer:innenzahlen und Corona überhaupt noch eine Zukunft hat.
Ron Iyamu ist seit Ende Januar krankgeschrieben. Er fühlt sich vom Schauspielhaus im Stich gelassen. „Was mich viel mehr verletzt hat als die rassistischen Witze von Armin Petras oder die Cuttermesser-Situation war, dass der Intendant Bescheid wusste, aber sich nicht gekümmert hat.“
Den letzten Rest gab ihm ein Telefonat mit dem Leiter des Jungen Schauspiels, der rumgewitzelt haben soll, er hätte Wilfried Schulz beruhigt, dass Ron Iyamu ihm nicht nach dem Leben trachte. Er habe sich damit auf jenes Musikvideo bezogen, sagt Iyamu, das er für „Dantons Tod“ produziert hatte, das aber nie gezeigt worden war. Iyamu wollte es im Zuge von Black Lives Matter 2020 gern veröffentlichen.
Doch die künstlerische Leitung des Hauses habe Bedenken geäußert, sagt Iyamu. Sie habe sich Sorgen gemacht, dass die expliziten Lyrics, in denen zur Revolution gegen das verstaubte, weiße Stadttheater aufgerufen wird, zu realer Gewalt gegen das Haus führen könnten. Auch wenn das Video schlussendlich online gestellt wurde, hätte ihn die Diskussion darum schockiert.
„Ich mache Kunst für eine Theaterproduktion von Armin Petras, mache die Sprache auf seinen Wunsch hin gewaltvoller – und muss mir am Ende so etwas anhören? Ich wage zu bezweifeln, dass das einem weißen Kollegen auch so passiert wäre.“
Ron Iyamu hat es trotzdem noch mal versucht. Er wechselte im Herbst in die Kinder- und Jugendsparte des Düsseldorfer Schauspielhauses. Doch dann habe er für eine Improvisation zwei Küchenmesser vom Requisitentisch nehmen wollen, um damit auf die Bühne zu gehen, erzählt er. „Und dann musste ich innehalten und hatte diese zwei Messer in der Hand und habe festgestellt, dass ich das nicht mehr kann.“
Auch diese Revolution frisst ihre Kinder. Iyamu wird das Theater verlassen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen











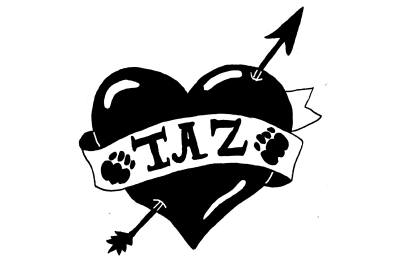
meistkommentiert
Ricarda Lang über Strategie der Grünen
„Die Schuldenlast tragen die Falschen“
Illegales Autorennen in Ludwigsburg
Männer mit Mercedes im Kopf
Stand der Koalitionsverhandlungen
Bitterer Vorgeschmack
Schlechte Zahlen der Deutschen Bahn
It’s Daseinsvorsorge, stupid
US-Schutzzölle gegen Autoindustrie
Europa sucht nach einer Antwort
Angriff auf Informationsfreiheit
Amthors Rache