„Rambo Last Blood“ im Kino: Toxische Männlichkeit am Stock
„Rambo Last Blood“ ist ein böser Traum aus Rassismus, Selbstmitleid und Misogynie. Und eine Illustration der Abgründe der Trump-Ära.
Rotglühend geht die Sonne auf. Die Latina-Haushälterin kocht Kaffee für den müden Helden John Rambo (Sylvester Stallone), der als Pferdezüchter mit Jeansjacke und Stetson in Arizona seinen Lebensabend fristet. Die Ranch-Szenerie ist ein sandfarbenes Americana-Klischee, ein Norman-Rockwell-Idyll. Unter der hübschen Oberfläche hat Rambo, den Stallone wie immer wortkarg und mit steinerner Mimik gibt, ein Tunnelsystem angelegt.
Das ist eine Referenz an „Rambo 2“, in dem Stallone in den 80er Jahren im Kino im Alleingang den Vietnamkrieg gewann (und an den Vietcong, der sich in Tunneln vor den US-Bomben verbarg). Dieser Tunnel ist ein metaphorischer Raum, in dem der Held seine finstereren Erinnerungen an Krieg und Gewalt eingebunkert hat.
Nun droht Veränderung: Rambos Nichte und Ersatztochter Gabrielle (hübsch und leer: Yvette Monreal), gleichsam seine „Familie“, will die Ranch verlassen und aufs College gehen. Frauen, die etwas wollen (ziemlich egal, was), sind in Rambo-Filmen immer Vorboten eines Gewaltorkans.
In den 80er Jahren tauchten mit Stallone, Chuck Norris und Arnold Schwarzenegger nicht zufällig Muskelhelden auf. Die proletarischen Körper waren in den automatisierten Fabriken nichts mehr wert. Sie wurden ästhetisch, hypertrophe Kunstprodukte, die in Fitnesscentern, den neuen Kathedralen des Maskulinen, geschaffen wurden. Die wortkargen Helden waren seltsame Mixturen: halb Maschine, wie die Terminator-Filme überdeutlich zeigten, halb Wilde.
John Rambo, so war es in der ersten komplexen, kritischen Rambo-Episode „First Blood“ (1982) zu erfahren, hat deutsche und indianische Vorfahren und massakrierte seine Feinde mit Messer und Pfeil und Bogen. Stallones Figuren Rambo und Rocky verkörperten die Wut der weißen Arbeiterklasse, die niemand mehr brauchte, nachdem die Fabriken dichtgemacht hatten. In der mittlerweile achtteiligen Rocky-Saga blitzt in einigen Augenblicken auf, dass nicht der Russe, nicht der schwarze Konkurrent, sondern der Kapitalismus das Problem ist.
Keine Selbstreflexion, nichts Spielerisches
Als Körperschauspieler alt zu werden ist nicht einfach. Der Verfall ist, trotz Muskelpräparaten und der Operation, die in Stallones Gesicht unschöne Spuren hinterlassen hat, unaufhaltbar. Das Kapital der Muskelhelden löst sich buchstäblich auf. Stallone, 73 Jahre alt, ist indes nicht nur Körperschauspieler, sondern als Drehbuchautor und Regisseur so etwas wie einer der letzten Autorenfilmer in Hollywood.
Er hat in den letzten zehn Jahren eine trotzige Antwort auf das Drama der alternden Körperhelden geschaffen: den Rentner-Actionfilm. In der sehr schlicht gestrickten Trilogie „The Expendables“ gibt es neben den üblichen Schurken, digitalfreier, nach Schweiß und Diesel riechender Action ein paar hübsche Cameo-Auftritte von Schwarzenegger und Bruce Willis. Und ein paar Momente ironisch gebrochener Alterswürde.
„Last Blood“ hat nichts davon. Keine Selbstreflexion, nichts Spielerisches. „Last Blood“ ist ein neurotisches Psychogramm des alten weißen Amerika in den Zeiten von Donald Trump, angetrieben von kaputten Ängsten und bodenloser Wut. Die Story überraschungsfrei zu nennen wäre untertrieben. Die Nichte Gabrielle wird in Mexiko von der Mafia entführt, geschlagen und geschunden, zur Prostitution gezwungen und getötet.
Mexiko als Abgrund aus Dreck
Stallone wird, wie in allen vier Rambo-Filmen zuvor, erst zu blutigem Brei geprügelt, ehe der pflichtgemäße Rachefeldzug beginnt, der vorhersehbar in dem Vietcong-Tunnel endet. „Death is coming“, sagt er, trennt Köpfe ab, drückt Kehlköpfe ein. Knochen splittern, Arme und Beine fliegen durch die Luft. Der Soundtrack feiert jede spritzende Wunde und Blutfontäne als Sieg. Rambo feuert MG-Salven noch auf Leichen und trennt am Ende mit einem Schlachtermesser den Brustkorb eines Schurken auf und reißt ihm mit der blanken Hand das Herz heraus. Rambo kann nicht ironisch werden, deshalb wird die Gewalt hysterisch.
Als Gabrielle mit dem Auto die Grenze zu Mexiko überquert, fährt die Kamera in die Höhe und der Soundtrack annonciert, dass dies das Tor zur Hölle ist. Mexiko ist ein Abgrund aus Dreck, Korruption und Gewalt. Einmal stürzt sich eine Horde mexikanischer Polizisten auf blutig geschlagene gefangene Frauen, um sie zu vergewaltigen.
Im Kino, sagt Jean-Luc Godard, glauben wir an die Wirklichkeit des Films und nicht daran, dass der Film die Wirklichkeit spiegelt. Das Referenzsystem von Filmbildern sind Filmbilder, nicht Präsidenten. Doch die Mexiko-Inszenierung in „Last Blood“ bebildert überdeutlich Trumps rassistisches Klischee, dass aus Mexiko nur Drogen, Kriminalität und Vergewaltiger kommen.
„Last Blood“ ist keine Geschichte, in der ein Actionheld (wie in den Filmen mit Vin Diesel oder Bruce Willis) mit infantiler Lust etwas kaputtmacht und noch im Gewaltexzess etwas von der kindlichen Freude spürbar ist, etwas in die Luft zu jagen. Rambo war immer faschistischer als die anderen Körperhelden. Frauen existieren in seinem Universum fast nur, um Rachefeldzüge in Gang zu setzen.
„Wie dunkel das Herz eines Mannes sein kann“
Mitunter schienen die Blutbäder, die er anrichtet, eine Art Abwehr gegen ihre Verführungen zu sein, die den männlichen Körperpanzer zu erweichen drohten. Rambo schien nur lebendig zu sein, wenn er gefoltert wurde oder folterte, töten und schlachten durfte und alles Lustvolle, Sexuelle verbannt war. Die Rambo-Filme siedeln sehr nahe an faschistischer Todessehnsucht.
Empfohlener externer Inhalt
"Rambo – Last Blood" im Trailer

Nur Gabrielles Unschuld, sagt Rambo in „Last Blood“, habe ihn vor seinen Dämonen gerettet. Doch Gabrielle, „die reine Unschuld“, wie mehrmals betont, will ihn und die Ranch verlassen. In Mexiko fragt eine Freundin Gabrielle, ob sie etwa noch Jungfrau sei. Die Körper, die sich im Stroboskoplicht in der Disco in Mexiko erotisch bewegen, sind Zeichen schrecklicher Gefahr – der Film suggeriert, für Gabrielle, aber eigentlich für Rambo. „Du weißt nicht, wie dunkel das Herz eines Mannes sein kann“, sagt er finster zu seiner angebeteten Ersatztochter. „Last Blood“ ist vielleicht die sexualneurotisch aufgeladene Fantasie eines alten Mannes, der eine südländische Traumlandschaft aus Sex und Gewalt erfindet, um die Frau zu bestrafen, die ihn verlässt.
„Last Blood“ erzählt nicht die Geschichte eines Helden, der eine in Unordnung geratene Welt rabiat wieder ins Lot bringt. Am Ende liegt ja alles in Trümmern, Stallone blutend in einem Schaukelstuhl auf der Terrasse seiner Ranch, die aussieht wie ein Schlachtfeld. Die Feinde sind zerfetzt, seine „Familie“ ist vernichtet. Es gibt nur noch ihn. Im letzten Bild reitet er auf dem Pferd gen Horizont.
„Rambo: Last Blood“. Regie: Adrian Grunberg. Mit Sylvester Stallone, Paz Vega u. a., USA 2019, 100 Min.
Der gar nicht mal heimliche Traum der Rambo-Figur ist es, alles „zu kontrollieren“, so sagt er es wirklich. Sein Wunschtraum ist eine Welt ohne Veränderung, völlig kontrollierbar und gereinigt von allem Lebendigen (und das erinnert uns an manche rechtspopulistischen Angstbilder). In dieser gefrorenen, engen Welt gibt es für den Helden keine Erlösung, nicht in der Familie, nicht in der Einsamkeit. Noch nicht mal im Tod.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen















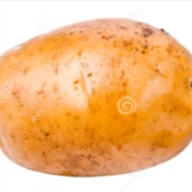
meistkommentiert
USA und AfD
„Getarnte Tyrannei“
Gesichert rechtsextreme Partei
Rufe nach einem AfD-Verbot werden lauter
Geflüchtete Jesid:innen
Abgeschoben in das Land des Genozids
Blockade in Gaza
Bittere Hungersnot mit Ansage
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer
Und das soll bürgerlich sein?
Dobrindt als Bundesinnenminister
Anheizer. Analytiker. Alexander