Quotendiskussion in der Filmbranche: Auf beiden Seiten des Tisches
Frauen führen seltener Regie und erhalten weniger Fördergelder. Franziska Stünkel, Filmregisseurin in Hannover, kritisiert das.

242. So viele Regisseurinnen und Regisseure stehen bisher hinter dem Aufruf des Vereins Pro Quote Regie. Eine von ihnen ist die Regisseurin und Fotokünstlerin Franziska Stünkel. Sie erwartet ganz pragmatisch, dass sich der Anteil von Frauen in der Gesellschaft zeitgemäß nun auch in ihrem Beruf erhöht.
Der Bundesverband Regie (BVR) hat mit seinem ersten „Regie-Diversitätsbericht“ im November die bereits schwelende Diskussion über mehr Frauen in Filmprojekten weiter genährt. Bei den über vier Jahre ausgewerteten TV-Programmen von ARD und ZDF in der Primetime führten demnach durchschnittlich 11 Prozent Frauen bei fiktionalen Filmen Regie. Bei den Kinofilmen waren es 22 Prozent. Im High-Budget-Bereich ab fünf Millionen Euro sinkt ihr Anteil auf rund 10 Prozent.
Das erklärt auch, weswegen die von der Filmförderungsanstalt (FFA) an Regisseurinnen vergebenen Gelder prozentual geringer sind als der Frauenanteil bei den geförderten Projekten selbst. Am Nachwuchs kann es zahlenmäßig nicht liegen: Laut Pro Quote liegt der Frauenanteil unter den Absolventen von Filmhochschulen bei 42 Prozent. Rein rechnerisch entsteht eine auffällige Lücke, die neben Doris Dörrie und Caroline Link auch Stünkel alarmierte.
Im nicht gerade mit der Filmindustrie assoziierten Hannover lebt und arbeitet die 41-Jährige zwischen ihren Recherchereisen, Filmprojekten und Ausstellungen. Hier ist es ihr gelungen, sich zu behaupten. Unabhängig vom Geschlecht, wie sie sagt. Von der Stadt erhielt sie im November den Preis „Frauen machen Standort“ für ihre unternehmerischen Leistungen als Regisseurin und Filmproduzentin und als „Mutmacherin“ für Frauen in der Kreativbranche. Für Stünkel Selbstverständlichkeiten. Umso ernüchternder war die Auseinandersetzung mit den Zahlen.
Sich behaupten, unabhängig vom Geschlecht
„Ich ahnte schon, dass es eine Schieflage gibt. Nun bin ich gerne Teil von denen, die das hinterfragen“, sagt Stünkel. „Wir arbeiten ja alle intensiv an unseren Projekten und sind dann im jeweiligen Kosmos gefangen. Doch das Thema geht uns alle an, mit unseren unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen. Sich hier auszutauschen und aktiv zu werden, ist ein gutes Gefühl“, sagt Stünkel. Benachteiligungen im eigenen Berufsleben führt sie nicht als Grund für ihr Engagement an.
Da Filmprojekte teuer sind, ist es für weibliche wie männliche Regisseure und Produzenten existenziell, Sendergremien, Stipendienjurys, Filmförderanstalten und Banken für sich zu gewinnen. Stünkel kennt dies seit ihren „langen, harten Wegen“ für erste Kurzfilme. „Da bin ich von Stiftung zu Stiftung gerannt. Die Nordmedia Filmförderung gab es hier damals noch nicht.“ Und doch vertrauten die Banken der jungen Studentin und Firmengründerin, sodass sie die hohen Summen für das 35-mm-Filmmaterial und die Gerätemiete zusammenbekam.
Dennoch seien damals Attribute wie Stärke, Führungskompetenz, Umgang mit Finanzen eher Männern zugeschrieben worden. „Das hat sich zwar schon gewandelt. Aber es ist alles noch im Prozess. Auch im Regieberuf.“
Mit der Zeit lernte sie, ihre Ideen in „handwerklich korrekte Konzepte“ zu gießen. Bei ihrem ersten Kinofilm, „Vineta“ (2008), war Stünkel Co-Produzentin, schrieb das Drehbuch und führte Regie. „Ich finde es sehr schön, mit einer paritätischen Besetzung am Set zu arbeiten. Darauf achte ich schon bei der Auswahl.“
„Wir selbst sind eine Geschichte“
An den Regieauftrag für den 18-stündigen Dokumentarfilm „Tag der Norddeutschen“ für den Norddeutschen Rundfunk (NDR) kam sie über eine Produktionsfirma in Hannover. Das wäre einem männlichen Kollegen genauso ergangen. Heute wendet sie sich wieder fiktionalen Stoffen zu. „Im echten Leben sehen wir Geschichten, wir selbst sind eine Geschichte. Von daher ist dokumentarisch und fiktional relativ ähnlich.“
Gerade schreibt sie an zwei Kinospielfilmen, deren Inhalte nicht entgegengesetzter liegen könnten: „Nahschuss“ über die letzte Vollstreckung eines Todesurteils in der DDR und eine Komödie über und aus Frauensicht. Wie immer werde die Finanzierung erst mit fertigem Drehbuch angegangen. Dann zieht auch Stünkel wieder vor eine Kommission, ein Vergabegremium.
Sie will weder Schuld zuweisen noch Vorurteile bedienen, aber sie findet: „Eine paritätische Besetzung von Entscheidungsgremien vorab ist eine Ausgangsbasis. Sodass aus dem weiblichen und männlichen Blick heraus über Projekte entschieden werden kann. Das gibt es zum Teil, zum Teil noch nicht. Bei manchen Gremien habe ich mich schon nach paritätischem Denken gesehnt.“
Die Regisseurin kennt auch die „andere“ Seite des Tisches. Sie ist unter anderem Jurymitglied beim Cast & Cut Kurzfilm-Stipendium. Da denkt Stünkel nicht an Quote oder Solidarität. „Es geht darum, die künstlerische Regiehandschrift zu erkennen, wie die Denkweise ist, die Umsetzungskraft.“ Anonymisierte Anträge etwa würden ihr bei der Auswahl nicht helfen. „Das wäre ein Projekt, das frei im Raum schweben würde. Wir müssen den ganzen Menschen dabei sehen.“ Bisher gingen diese Stipendien auch hälftig an Frauen und Männer. Ein seltenes Positivbeispiel?
Eine Studie soll Pro Quote zufolge nun untersuchen, welches die Gründe für die Vergabepraxis von Fördergeldern und Regieaufträgen sind. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Monika Grütters, habe die FFA beauftragt herausfinden, wie es von den offenbar reichlichen Hochschulabgängerinnen zu dem geringen Frauenanteil im Regiebereich und bei den Fördermittelvergaben kommt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen




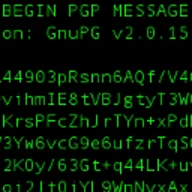
meistkommentiert
Wahl der Bundesverfassungsrichter:innen
Spahns miese Tricks
Grund für Scheitern
Unions-Probleme verhindern Wahl
Nahostkonflikt
USA sanktionieren UN-Sonderberichterstatterin Albanese
AfD und CDU
Der Kulturkampf hat das höchste Gericht erreicht
Nakba-Demo in Berlin
Neue Recherche erhärtet Zweifel an Berliner Polizei
Inhaftierte Aktivist*in in Ungarn
„Herr Wadephul muss Maja T. zurück nach Hause holen“