Präsidentschaftskandidat Joe Biden: Kandidat Kellerkind
Dank Corona kann Joe Biden keinen Wahlkampf führen, sondern sitzt zu Hause. Und jetzt gibt es neue Indizien für frühere sexuelle Übergriffe.
In normalen Zeiten wäre Joe Biden, der designierte Kandidat der US-Demokrat*innen für die Präsidentschaftswahl Anfang November, jetzt auf Wahlkampftour. Er würde nach dem Verzicht seines letzten verbliebenen Kontrahenten, Bernie Sanders, eine Siegesrunde durch verschiedene Bundesstaaten drehen und Spenden einsammeln. Er würde so viele Hände schütteln wie möglich. Er würde auf großen Bühnen unter lautem Jubel die Unterstützung ehemaliger Konkurrent*innen entgegennehmen.
Vielleicht würde er einige europäische Hauptstädte besuchen, um sich auf internationalem Parkett als Staatsmann zu präsentieren. Und er würde sich genau überlegen, wie die Nominierung einer Vizepräsidentschaftskandidatin – Biden hat schon vor Wochen angekündigt, es werde eine Frau – möglichst spektakulär zu inszenieren wäre, um so viel Fernsehberichterstattung zu generieren wie irgend möglich.
Aber nichts ist normal. Joe Biden, 77, zur Risikogruppe für die Covid-19-Krankheit gehörend, geht nirgendwo hin. Er sitzt im Keller seines Landhauses, den er leidlich als Studio für Interviews und Videokonferenzen hergerichtet hat. Zwei seiner Enkelkinder, die nicht weit weg wohnen, kommen ab und an vorbei und er unterhält sich von der Veranda aus mit ihnen, auf Abstand.
In der Berichterstattung der Medien taucht Biden fast überhaupt nicht auf. Die Coronakrise ist die Zeit der Exekutive, und im direkten Vergleich mit dem US-Präsidenten ist der Anteil an Sendeminuten derzeit 9:1 für Donald Trump. Mit dem für Biden nicht wirklich schmeichelhaften Ergebnis, dass er in den Umfragen in wichtigen Swing States wie Pennsylvania, Michigan und Florida eine deutliche Führung vor Trump aufgebaut hat. Wenn Biden still ist, kann er gewinnen.
Bedrängt und zwischen die Beine gefasst
Da kommt die Nachricht davon, dass sich Berichte über sexuelle Übergriffe des damaligen Senators Biden im Jahr 1993 erhärten, nicht so gut. Tara Reade, damals 29, hatte zwischen 1992 und 1993 im Stab des damaligen Senators Joe Biden in Kalifornien gearbeitet. Im März dieses Jahres berichtete sie, Biden habe sie damals bedrängt, sich an ihr gerieben, sie zwischen die Beine gefasst. Schließlich wurde sie gefeuert. Bidens Wahlkampfteam wies die Vorwürfe rundheraus zurück – nichts von alldem sei wahr. Biden selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.
Aber zumindest für Tara Reade – bis heute Mitglied der Demokratischen Partei, aktiv in verschiedenen NGOs und Expertin für häusliche Gewalt – waren die Ereignisse real. Sie sagt jetzt, unmittelbar danach ihrer Mutter davon erzählt zu haben. Die, eine engagierte Feministin, habe ihr geraten, zur Polizei zu gehen, was Reade aber nicht wollte. Und auch an die Presse wollte sie sich nicht wenden. Die Geschichte konnte zunächst nicht bestätigt werden: Reades Mutter starb vor einigen Jahren.
Jetzt aber tauchte, angeregt durch Reades Erinnerungen und nach Recherchen des Enthüllungsmagazins The Intercept, ein Video aus der damals auf CNN ausgestrahlten „Larry King Show“ auf. Eine anonyme Anruferin berichtet in der Sendung mit dem Thema „Grausames Washington“ über das Dilemma ihrer Tochter, der im Büro eines prominenten Senators Schlimmes widerfahren sei. Was man denn anderes tun könne, als zur Presse zu gehen, wollte die Frau wissen. Es war Tara Reades Mutter. Und auch eine ehemalige Nachbarin erinnert sich jetzt, 1995, zwei Jahre nach den Ereignissen, darüber mit Reade gesprochen zu haben.
Unter normalen Umständen wäre das jetzt ein Riesenthema. Die Biden-Kampagne würde alles daran setzen, den Vorwurf schnell vom Tisch zu bekommen, damit er schon zum Nominierungsparteitag (vermutlich) im August, erst recht aber im November, kein Thema mehr ist. Die Republikaner, ausgerechnet mit einem Kandidaten Trump, dem selbst sexuelle Übergriffe in viel größerem Maßstab zugeschrieben werden, würden die Grenzen testen, bis zu denen sie die Geschichte ausnutzen können.
Aber nichts ist normal in diesem Zeiten. Biden sitzt weiter in seinem Keller. Und Trump redet sich um Kopf und Kragen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









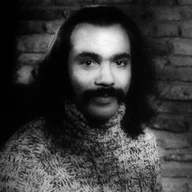

meistkommentiert
Illegales Autorennen in Ludwigsburg
Tod durch enthemmte Automobilisten
Tesla missachtet Arbeitsrecht
Der Autobauer drangsaliert kranke Mitarbeiter
Israelischer Bruch der Waffenruhe
Im Gazastreifen öffnen sich die Tore zur Hölle
Tod und Terror im Nahen Osten
Schweigen ist nicht neutral
Leistungsloses Einkommen
Warum Erben lieber über „Neid“ reden als über Gerechtigkeit
Neuer Ärger in der Linkspartei
Frieden war gestern