Markus Söders neueste Idee: Lass mal über Werte reden
Bayerns Ministerpräsident will Wertekunde-Unterricht für Kinder aus Migrantenfamilien. Keine schlechte Idee – und zwar am besten für alle.
E s vergeht kaum mehr ein Morgen, an dem keiner unserer liebsten mittelalten weißen Männer etwas im wahrsten Sinne des Wortes Aufregendes sagt. Jetzt will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die ohnehin schon vom Stigma-Stempel „Migrationshintergrund“ gebrandmarkten Kinder von Zugewanderten in deutscher Wertekunde unterrichten. Im Interview mit der Bild am Sonntag (BamS) sagte Söder: „Wir führen sogenannte Deutschklassen ein. Dort wird Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien intensiv Deutsch vermittelt, aber gleichzeitig auch Wertekunde. Nur diejenigen Schüler kommen dann in den Regelunterricht, die unsere Sprache sprechen und unsere Werte verstehen.“
Erster Gedanke: Völliger Blödsinn. Mal ganz davon abgesehen, dass allein Söders Hinweis auf das Sprechen „unserer Sprache“ (Hochdeutsch oder Bairisch?) in Zeiten von Multilingualität und einer sich ständig verändernden Sprachlandschaft undifferenziert daherkommt, bleibt diese Forderung ein trauriges Symptom unseres Integrationsverständnisses. Die klare Botschaft: Integration ist eigentlich mehr so Assimilation, denn ihr (die anderen) müsst unsere Werte (meins, meins, meins!) erst noch in der Schule lernen.
Man stelle sich die Szene auf dem Schulhof vor: Valentin (7) und Sophie-Helene (fast 8) wissen von kartoffeldeutschem Haus aus logischerweise schon alles über „unsere“ Werte und dürfen sich deshalb Bruchrechnung, englischen Vokabellisten und somit dem direkten Weg zum Abitur widmen. Maja (auch fast 8) und Esra (wirklich schon 8) müssen leider noch in den Werte-Förderunterricht, denn Ethik ist außerhalb des Westens nirgends je angekommen. Eine Grundschul-Dystopie, die Kinder aus Migrantenfamilien ungeachtet von Milieuzugehörigkeit in einen Topf wirft, ihnen noch einen fetten Stein mehr in den Weg legt und von früh auf vermittelt: Wir sind schlauer als ihr – und nur ihr habt Aufholbedarf.
Jetzt könnte dieser neueste Söder’sche Gedankenerguss aber auch etwas Gutes sein; nämlich Anlass zu einer Debatte darüber, welche Werte wir allen Schülerinnen und Schülern in diesem Land vermitteln wollen.
Markus Söder (schon 51) verspricht sich vom Wertekunde-Unterricht für Migranten, dass dieser Intoleranz und Antisemitismus vorbeugen kann. Aber Intoleranz und Antisemitismus gehen uns alle an, ebenso wie Rassismus, Sexismus oder Homophobie. Strukturelle Diskriminierung ist unser tagtäglich selbstgemachtes Systemproblem: Herr Weber bekommt die Wohnung oft eher als Herr Truong, der Mann den Job eher als die Frau, „schwul“ und „behindert“ gelten allzu oft noch als Beleidigungen. Skandalös ist auch die bis heute anhaltende Unsichtbarkeit deutscher Kolonialgeschichte, die fehlende Aufarbeitung von Verbrechen und Ausbeutung unter deutscher Fahne und somit auch das Fehlen einer postkolonialen Perspektive im Schulsystem.
Keine Utopie
Was, wenn in der Schule, ungeachtet von Reisepass und Religion, Diversität gelehrt würde, anstelle des klassischen Duos Toleranz (Deckwort für „Ich bin privilegierter, also erlaube ich“) und Anpassung? Klingt fast romantisch, ist aber keine Utopie, sondern bildungspolitisch umsetzbar.
Es ist eine Chance, dass Kinder diverser Herkunftsgeschichte neue Perspektiven zur Frage einbringen, in welchem Deutschland wir – und zwar wir alle – gut und gerne leben wollen. Valentin und Esra könnten im gemeinsamen Fach Wertekunde wahrscheinlich deutlich mehr voneinander lernen, als Söder so glaubt.
Eigentlich sagt er es ja selbst, vielleicht ohne es zu verstehen: „Bayern ist christlich-abendländisch geprägt mit jüdischen und humanistischen Wurzeln.“ Die Wurzeln unserer Werte liegen, noch vor jeglichen religiösen Überzeugungen, in der Humanität und den Menschenrechten. Beides ist wichtig genug, um alle mindestens ein Mal darin zu unterrichten, sei es in der Schule oder im Rahmen einer verpflichtenden Weiterbildung für Berufspolitiker.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








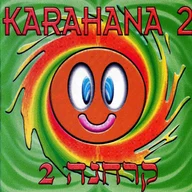

meistkommentiert