Kolumne Psycho: Für ein Verschleierungsverbot
Die Diagnose einer psychischen Krankheit ist kein Todesurteil. Im Zweifel hilft sie sogar beim Überleben. Also Schluss mit den Euphemismen!

M eistens ist es eine gute Idee, die Dinge beim Namen zu nennen. Etwa „Holocaust“ statt „Endlösung der Judenfrage“, „Menstruation“ statt „Besuch von Tante Rosa“ und „Klimawandel“ statt „Wetterextrem“. Denn auch wenn Donald Trump den Klimawandel nicht wahrhaben will – er wird nicht weggehen, nur weil Trump den Mitarbeitern des Agrarministeriums verbietet, das Wort zu benutzen und es mal eben durch ein anderes ersetzt.
Dinge verschwinden nicht einfach, indem man sie umbenennt. Genau wie Kinder beim Versteckspielen, die immer noch da sind, auch wenn sie sich die Augen zuhalten. Oder Lord Voldemort aus „Harry Potter“, dessen Umschreibung „Er, dessen Name nicht genannt werden darf“ seinen Gruselfaktor sogar noch steigert.
Meine Freundin Helen und ich streiten uns regelmäßig darüber, ob man psychische Störungen und Krankheiten explizit benennen sollte. Sie findet: nein. Sie argumentiert mit Schubladen, Stempeln und Stigmata. Erklärt, eine Diagnose könne erstens falsch sein und würde zweitens ihre persönliche Freiheit einschränken. Nur weil sie eine Depression habe, sei sie ja noch lange nicht wie alle anderen Depressiven. Ich sehe das anders. Weil Freiheit erst beginnt, wenn man die Fakten kennt. Zumindest ist das meine Erfahrung.
Ich verstand lange nicht, was mit mir los ist, konnte die Panikattacken nicht einordnen, hatte zwar eine diffuse Idee von diesem „Angstscheiß“, der mich immer wieder befiel, aber kein besseres Wort dafür. In vielen Situationen, in denen ich panisch war, spürte ich eine Distanz zu den Menschen in meinem Umfeld, die ganz anders reagierten als ich. Natürlich ging ich davon aus, dass sie normal sind und ich nicht, schließlich waren sie in der Mehrheit. Aber wenn sie normal waren, was war dann ich? Irre? Verrückt? Übergeschnappt?
Was für eine Erleichterung, als ich endlich die Diagnose bekam: Angststörung. Auf einmal wurde der Schatten greifbar. Auf einmal konnte ich anderen Menschen mitteilen, was mit mir los ist. Konnte mich informieren und fand heraus: Ich bin nicht allein. Und vor allem: nicht verrückt.
Es hilft niemandem, um den heißen Brei herumzureden. Wenn ich mich um das Wohlergehen einer Person sorge, muss ich wissen, was mit ihr los ist. Die Diagnose einer psychischen Krankheit ist kein Todesurteil, auch kein gesellschaftliches. Im Zweifel hilft sie einem sogar, zu überleben.
Denn was soll ich mit der Information anfangen, dass Hans „in einer anderen Welt lebt“? Fragen, ob dort noch Platz für uns ist, wenn die „Wetterextreme“ überhandnehmen? Was damit, dass Antje „manchmal so Phasen hat“? Hat sie die einmal im Monat, während sie blutet, oder ist sie vielleicht depressiv? Und die „wunderliche“ Kirsten – hat sie einfach nur ein Interesse an Esoterik oder eine soziale Phobie?
Wer derart verschlüsselt kommuniziert, darf sich nicht wundern, wenn in der Folge Gerüchte kursieren und Leute auf Distanz gehen.
Ich plädiere deshalb für ein Verschleierungsverbot. Für Worte, nicht für Menschen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





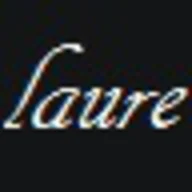
meistkommentiert