G20-Fahndung im rechtsfreien Raum: Klage gegen Datenschutz
Hamburgs Innenbehörde klagt gegen den Datenschutzbeauftragten. Der will die Datenbanken löschen, aus denen sich G20-Fahndungserfolge speisen.

Nun geht der Streit zwischen Innenbehörde und Datenschutzbeauftragtem um den Einsatz der biometrischen Gesichtserkennung durch die Polizei endgültig vor Gericht.
Knapp einen Monat nachdem der Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar am 18. Dezember die Löschung der im Rahmen der G20-Ermittlungen aufgebauten „biometrischen Referenzdatenbank“ angeordnet hat, hat die Innenbehörde am Dienstag Klage gegen die Anordnung vor dem Oberverwaltungsgericht einreicht. Sie geht davon aus, dass diese „rechtswidrig ergangen“ sei.
Die Klage hat aufschiebende Wirkung gegen Caspars Anordnung, die Daten bleiben bis zum Urteil ungelöscht. Innenbehörden-Sprecher Frank Reschreiter kündigte gegenüber der taz an, sie „weiter einzusetzen“.
Was es für die Rechtspraxis bedeutet, sollte das Gericht Caspar am Ende Recht geben, ist unabsehbar. In vielen G20-Verfahren gegen mutmaßlich militante DemonstrantInnen spielen die durch die Software „Videmo 360“ gewonnenen Daten für die Identifizierung der Tatverdächtigen eine wesentliche Rolle.
Was, wenn G20-Urteile auf rechtswidrigen Beweisen beruhen?
Innensenator Andy Grote (SPD) betont immer wieder, ohne Videmo 360 hätte es bei der Fahndung nach G20-Straftätern kaum Ermittlungserfolge gegeben. Aber sollten Anklage und Verurteilung von Tatverdächtigen auf rechtswidrig erworbenen Beweismitteln beruhen, haben die Gerichte und auch Grote ein Problem – viele Verfahren müssten möglicherweise neu aufgerollt werden. „Das müssen dann im Einzelfall die Richter entscheiden“, sagt Reschreiter.
Welchen weitreichenden Einfluss die umstrittene Software auf die G20-Strafverfahren hat, lässt sich beim Prozess gegen fünf Angeklagte erkennen, die an dem Aufmarsch durch die Elbchaussee teilgenommen haben sollen, aus dem heraus zahlreiche Straftaten begangen wurden.
Von vier der Angeklagten hat die Polizei dank Videmo 360 ein mehrtägiges, fast lückenloses Bewegungsprofil von ihrer Ankunft in Hamburg bis zu ihrer Abreise erstellt. Wer die Ermittlungsakten liest, erkennt sofort: „Big Brother is watching you“ – und das rund um die Uhr. Ohne Einsatz der Identifizierungs-Software wäre es der Staatsanwaltschaft vermutlich unmöglich gewesen, eine Anklageerhebung zu erreichen.
„Nie da gewesene Kontrollmacht“
Caspar, der erst seit Kurzem die Kompetenz hat, den Einsatz von datenschutzrechtlich bedenklichen Instrumenten zu untersagen, hatte moniert, dass die Software solche Bewegungsprofile von Tatverdächtigen aber eben auch von völlig unbeteiligten Personen erstelle. Vermutlich seien „Hunderttausende“ davon betroffen, die entstehende biometrische Datenbank bedeute „eine nie da gewesene Kontrollmacht für staatliche Stellen, die im Besitz von Bildern sind“. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage.
„Wir haben die Nutzung datenschutzrechtlich intensiv geprüft und sehen den Einsatz von einschlägigen Rechtsgutachten gedeckt“, hält Reschreiter dagegen. Der FDP reicht das nicht: Sie fordert am heutigen Mittwoch in der Bürgerschaft vom Senat eine „Bundesratsinitiative für die Schaffung einer spezifischen Rechtsgrundlage zur Nutzung von Gesichtsanalysesoftware durch die Strafverfolgungsbehörden“. Ohne diese, so die Liberalen, agiere die Polizei im rechtsfreien Raum und die Grundrechte der Betroffenen seien nicht definiert und damit nicht existent.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
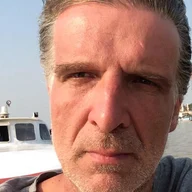




meistkommentiert