Debatte um Verkehrswende: Böse Autos, gute Autos
SUVs und alte Diesel sind eindeutig böse. Doch was ist mit Elektrofahrzeugen? Auch in Öko-Mobilitätskonzepten spielen PKWs eine entscheidende Rolle.
Je größer der Wagen und sein Spritverbrauch, umso größer der Hass, und wenn dann auch noch Fußgänger sterben wie vor einer Woche in Berlin, herrscht Empörung auf den Titelseiten. Andererseits spielen PKWs in allen Mobilitätsszenarien der Zukunft eine wichtige Rolle. Doch wie viel Auto ist sinnvoll? Bestimmt die Antriebsart oder die Nutzung darüber, ob ein Auto gut oder böse ist? Und was ist davon zu halten, dass die „bösen“ Autokonzerne sich zum Vorreiter einer klimafreundlichen Mobilitätswende erklären?
Für viele ist die Antwort auf die Frage, ob das Auto gut oder böse ist, ganz schlicht: Diesel ist doof, Benzin bisschen besser, Elektroantrieb einfach enorm. Für viele steht dieser für die Verkehrswende in der Republik. Ein Trugschluss.
Auch Elektroautos sind energie- und materialintensiv in der Herstellung und verstopfen Fahrbahnen und Straßenränder. Für den Elektromotor und die schweren Akkus braucht man spezielle Rohstoffe, deren Freisetzung die Umwelt massiv schädigt. Zwar emittieren sie keine Abgase dort, wo sie fahren, aber an anderer Stelle. Und selbst wenn der Autonutzer an einen Ökostromanbieter zahlt, kommt faktisch derselbe Strommix aus allen Steckdosen, ein Drittel klimaschädlicher Kohlestrom ist darunter. Und je mehr der bundesdeutsche Strombedarf – etwa auch durch Elektroautos – steigt, umso schwerer wird es, die Kohlekraftwerke zeitnah abzuschalten und deren Strom vollständig durch saubere Energien zu ersetzen.
Die meisten Ökobilanzstudien zeigen, dass Elektroautos der Benzinvariante nur dann überlegen sind, wenn es sich entweder um Kleinwagen mit kleinen Batterien handelt oder um Autos, die auf eine große Laufleistung kommen und auf eine lange Lebensdauer. Klimaneutral aber sind auch sie mitnichten.
Autonome vor der Tür
„Gute Autos“ gibt es in den Szenarien vieler Mobilitätsforscher. Nur sind sie nicht mehr in Privathand, sondern Sharing-Cars oder Sammeltaxis. Da ein Wagen rund 90 Prozent seiner Zeit im Stand, aber nur 10 Prozent in voller Fahrt verbringt, könnte ein Sharing-System mit ausgelasteten Fahrzeugen die Autoflotte in den Städten gewaltig reduzieren.
Sammeltaxi-Anbieter wie Moia setzen ebenfalls auf diesen Effekt. Die Hamburger Grünen haben allerdings in ihrem jüngsten Mobilitätskonzept gezeigt, dass Taxi-Dienste erst dann konkurrenzfähig sind, wenn sie autonom fahren. Von Menschenhand durch die Stadt kutschiert zu werden, wird für die meisten Menschen immer ein Luxus bleiben, denn es ist mit Lohnkosten verbunden.
Und wenn man dann autonom fahrende Leih-Autos kostengünstig ordern und vor der Haustür besteigen könnte, würde der eigene PKW de facto überflüssig: Er wäre dann nur noch eine teurere, aber kaum schnellere Alternative.
Spannend ist, dass auch die deutschen Autobauer sich als Mobilitätsdienstleister neu erfinden. Sie steigen ins Car-Sharing- und Sammeltaxen-System ein, dessen Zweck es doch ist, die Zulassung an Neuwagen und damit den Absatz von VW, BMW, Audi und Co. drastisch zu reduzieren.
So steckt VW hinter Moia, und Daimler sowie BMW betreiben Drive Now und Share Now, den ehemaligen Car2Go-Service. Wie Fleischproduzenten, die neuerdings nebenbei auf Veggie-Produkte setzen, wollen sie so die neu entstehenden Märkte kontrollieren und sich lieber selbst Konkurrenz machen, als sich von anderen ausbooten zu lassen.
Doch all das gilt nur in den Metropolen. Auf dem Land fällt es nicht so ins Gewicht, wenn statt Benzin-Rückständen aus dem Auspuff nur Kohlendioxide aus dem Kraftwerks-Schornstein kommen. Und für Sammeltaxis gibt es dort, wo nicht einmal ein Bus fährt, keine Nachfrage, die groß genug wäre, Anbieter auf den Plan zu rufen. So ist derzeit nicht mal Moia in der Hamburger Peripherie verfügbar.
In der Provinz ist das Auto nicht gut oder böse: Es ist für die dort lebenden Menschen bis auf Weiteres einfach unverzichtbar.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

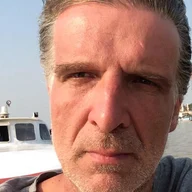





meistkommentiert
Arbeitszeitbetrug-Meme
Arbeitgeber hassen diesen Trick
Neue EU-Sanktionen gegen Russland
Zuckerbrot statt Peitsche
Indischer Schriftsteller Pankaj Mishra
„Gaza hat die westliche Glaubwürdigkeit untergraben“
Trump und Putin am Telefon
Nichts als Floskeln
Israelische Militäroffensive
Sinnlos in Gaza
Bundesanwaltschaft nimmt Jungnazis fest
Tatvorwurf: Terror