Coronamythen und Fakten (8): „PCR-Test ist unbrauchbar“
Kritiker*innen bezweifeln zu Unrecht die Aussagekraft des wichtigsten Corona-Nachweises. Ihre Annahmen beruhen teils auf Missverständnissen.

Diese Behauptung ist ein echter Klassiker, der in kaum einer Diskussion mit „Coronaskeptikern“ fehlt: Die weit verbreiteten PCR-Tests sind ein großer Schwindel, denn sie weisen gar keine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 nach. Ein prominenter Vertreter dieser These ist der Lungenarzt Wolfgang Wodarg.
Ein Teil der Aussage ist dabei formal nicht völlig falsch: Der PCR-Test weist tatsächlich nur nach, dass sich Teile der RNA, also des Virus-Genmaterials, im Rachenraum befunden haben, als dort ein Abstrich genommen wurde. Dass eine Infektion, also die Vermehrung der Virus-RNA in menschlichen Zellen, vorlag, wird dadurch nicht unmittelbar bewiesen – aber es ist eine logische Schlussfolgerung. Denn die Virus-RNA befindet sich ja nicht zufällig auf der Rachenschleimhaut eines Menschen, sondern weil eine Infektion vorliegt. Mittelbar weist der PCR-Test also doch nach, dass eine Infektion vorlag.
Die Behauptung vom unzuverlässigen Test
Eine andere Behauptung ist, dass PCR-Tests unzuverlässig sind. Sie seien nicht validiert – also unabhängig überprüft – und es gebe keine verbindlichen Standards für ihre Durchführung in den Laboren, heißt es etwa im „Corman-Drosten-Review“, einem von verschiedenen Wissenschaftler*innen verfassten, aber nicht in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlichten Papier, das in sozialen Medien gern geteilt wird.
Es ist eine absurde Situation: Die Corona-Infektionen und -Todesfälle in Deutschland steigen auf immer neue Höchststände. Doch ob bei Demonstrationen oder im Internet: Weiterhin werden wissenschaftliche Fakten angezweifelt oder komplett bestritten.
Die taz hat sich darum die wichtigsten Behauptungen der Corona-Skeptiker und -Leugner noch einmal vorgenommen und erklärt in diesem Dossier knapp und verständlich, warum diese nicht überzeugend sind. Wir wollen damit allen, die selbst Zweifel haben, Fakten präsentieren, die helfen, diese zu zerstreuen.
Alle Texte gesammelt finden Sie unter taz.de/coronamythen.
Das Dossier kann man sich
.Am Freitag, 18. Dezember, werden wir Ihnen ab 19 Uhr zudem in einem Video-Talk Fragen zum Thema beantworten.
Sie finden unsere Arbeit unterstützenswert? Dann klicken Sie doch bitte auf taz.de/zahl-ich
Aus der Sicht des Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Chanasit sind die im Papier erhobenen Vorwürfe „völlig absurd“. Dass es keine Standardprozedur für die Testdurchführung gebe, sei beispielsweise „richtig, aber unerheblich“, sagte er in der Welt. Das liege daran, dass das genaue Vorgehen von der jeweiligen Laborausstattung abhänge. Angaben zur Validierung wurden schon früh veröffentlicht und seitdem mehrfach bestätigt.
Andere Kritiker stellen nicht die Funktion des PCR-Tests insgesamt infrage, sondern bezweifeln seine Zuverlässigkeit: Die positiven Testergebnisse, so die Behauptung, seien zum Großteil nicht real, sondern sogenannte falsch-positive Ergebnisse. Aus dem Ergebnis von Vergleichstests zwischen Laboren, bei denen bis zu 2 Prozent der negativen Proben fälschlicherweise als positiv gewertet wurden, wird gefolgert, dass gerade bei niedrigen Infektionsraten fast alle positiven Tests falsch seien.
Diese Annahme beruht aber auf einem Missverständnis. Denn die Fehlerquote in diesen Untersuchungen bezieht sich nur auf den Nachweis einer einzelnen Gensequenz des Virus. In der Praxis analysieren die Labore meist zwei oder drei solche Sequenzen. Der Fehleranteil sinkt damit in den Bereich weniger Promille. Die deutsche Gesellschaft für Virologie kommt in einer aktuellen Stellungnahme zu einem klaren Ergebnis: „Die Zuverlässigkeit der Methode ist in umfassenden medizinischen und technischen Studien dokumentiert.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








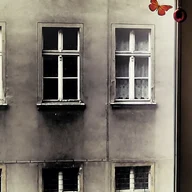
meistkommentiert