Shell-Jugendstudie 2024: Noch ist die Jugend nicht verloren
Die Autor*innen betonen das tolerante Menschenbild der jungen Generation. Gleichzeitig sehen sie unter jungen Männern autoritäre Tendenzen.

Die junge Generation sei „pragmatisch optimistisch“, heißt es in der Untersuchung. Als eine der Hauptursachen hierfür sehen die Macher*innen, dass 84 Prozent der Jugendlichen derzeit davon ausgehen, einmal ihre beruflichen Wünsche erfüllen zu können. 92 Prozent gehen davon aus, nach ihrer Berufsausbildung von ihrem Arbeitgeber übernommen zu werden – dieser Wert war noch nie so hoch in der Geschichte der Studie.
Grundsätzlich ist dabei sowohl jungen Männern als auch Frauen eine vielfältige Gesellschaft wichtig – bei Mädchen ist dieser Wunsch aber deutlich stärker ausgeprägt. 72 Prozent der jungen Frauen sprachen sich für eine bunte Gesellschaft aus, während es bei den Männern 56 Prozent waren. Jungs äußerten deutlich stärkere materialistische Wünsche und bewerteten Wettbewerb, Markenkleidung, schnelle Autos positiver, als Frauen es taten.
Als Langzeitprojekt untersucht die Shell Jugendstudie seit 1952 alle vier bis fünf Jahre die Lebenswelten und Perspektiven junger Menschen auf Familie, Beruf und politische Einstellung, wobei der heutige Abfragestandard erst Anfang der 2000er etabliert wurde. Für die 19. Jugendstudie wurden zu Beginn des Jahres 2.509 repräsentativ ausgewählte 12- bis 25-Jährige befragt.
Generation Greta ist over
Die letzte Studie wurde 2019 herausgegeben. Während damals alle von der progressiven „Generation Greta“ sprachen und Fridays for Future an ihrem Höhepunkt waren, hat sich der Zeitgeist gewandelt. Dazwischen liegen eine Pandemie und eine Welt voller Kriege, die sich geopolitisch neu ordnet.
Damit haben sich auch die Ängste verschoben. Es ist nicht so, als würde im Gegensatz zu 2019 etwa der Klimawandel keine Rolle mehr spielen. Nur sticht er nicht mehr so heraus. Das tun nun andere Krisen. Die Angst vor Kriegen, ob in der Ukraine oder im Nahen Osten, ist so groß wie nie. Sie hat sich fast verdoppelt von 46 auf 81 Prozent. Dazu kommt die Sorge um die wirtschaftliche Lage und Angst vor Armut. Und auch die wachsende zwischenmenschliche Feindseligkeit beunruhigt junge Menschen. Dabei ist auch die Angst vor Ausländerfeindlichkeit gewachsen und deutlich größer als die Angst vor Zuwanderung: 58 Prozent äußerten die Furcht vor rassistischer Gewalt, während 34 Prozent sich wegen der Zuwanderung in Deutschland sorgten – dieser Wert ist im Vergleich zu vor fünf Jahren fast unverändert.
Die Weltlage macht den 12- bis 25-Jährigen zwar Angst. Aber sie bewahren einen durchaus differenzierten Blick. Als Generation, die Krieg nie selbst erleben musste, hat sie ihm eine kritische Haltung gegenüber. So befürworten die jungen Menschen jeweils zu 60 Prozent die Nato und sehen Russland als Aggressor, der bestraft werden müsse. 13 Prozent widersprechen dem, etwa ein Viertel enthält sich. Waffenlieferungen und militärischer Unterstützung stehen sie aber wesentlich kritischer gegenüber.
Nur die Hälfte befürworten die Forderung, Deutschland sollte die Ukraine militärisch unterstützen. Etwa ein Viertel, 24 Prozent, lehnen das ab. Wenn es um die Frage geht, ob Deutschland eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel hätte, spalten sich die Meinungen zu je einem Drittel. Allgemein wird die Notwendigkeit fürs Militär gesehen, gleichzeitig wünschen sich viele einen Weg aus den Konflikten aufgezeigt zu bekommen. Da bleibt die Frage, ob die etablierten Parteien genug darauf eingehen.
Politisches Interesse hoch
In den derzeit bewegten Zeiten sind junge Erwachsene nicht ermüdet von der Politik. Sie sind interessierter denn je. Jede*r Zweite ist politisch interessiert und auch das Engagement wächst weiterhin. Sie glauben an die Demokratie und staatliche Institutionen, zugleich misstrauen sie Parteien und Regierung. Dieser Trend ist kein neuer: Auch 2019 war diese Unzufriedenheit mit Parteien und Politiker*innen zu beobachten.
Studienautorin Gudrun Quenzel sah in ihren Ergebnissen keine großen Differenzen zu einer Untersuchung des Sozialforschers Klaus Hurrelmann, der in diesem Frühjahr einen deutlich pessimistischeren Blick der Jugend zeichnete und ihr einen „deutlichen Rechtsruck“ attestierte. Autoritäre Tendenzen sehen auch die Autor*innen der Shell-Studie. Bestimmte Männlichkeitssterotype machen dabei vor allem junge Männer anfälliger für populistische und einfache Antworten, schließt die Studie.
Hinweis: Über den Stimmenanteil der jungen Menschen, die befürworten, die Ukraine militärisch zu unterstützen, haben wir missverständlich berichtet. Das ist nun geändert.
40.000 mal Danke!
40.000 Menschen beteiligen sich bei taz zahl ich – weil unabhängiger, kritischer Journalismus in diesen Zeiten gebraucht wird. Weil es die taz braucht. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken! Ihre Solidarität sorgt dafür, dass taz.de für alle frei zugänglich bleibt. Denn wir verstehen Journalismus nicht nur als Ware, sondern als öffentliches Gut. Was uns besonders macht? Sie, unsere Leser*innen. Sie wissen: Zahlen muss niemand, aber guter Journalismus hat seinen Preis. Und immer mehr machen mit und entscheiden sich für eine freiwillige Unterstützung der taz! Dieser Schub trägt uns gemeinsam in die Zukunft. Wir suchen auch weiterhin Unterstützung: suchen wir auch weiterhin Ihre Unterstützung. Setzen auch Sie jetzt ein Zeichen für kritischen Journalismus – schon mit 5 Euro im Monat! Jetzt unterstützen








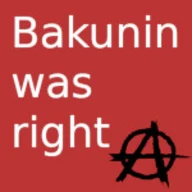


meistkommentiert
Social-Media-Star im Bundestagswahlkampf
Wie ein Phoenix aus der roten Asche
Start der Münchner Sicherheitskonferenz
Kulturkampf gegen Europa
Trump und die Ukraine
Europa hat die Ukraine verraten
Krieg und Rüstung
Klingelnde Kassen
Tabubruch der CDU
Einst eine Partei mit Werten
Zukunft der Ukraine
Gewissheiten waren gestern