Vertriebene in Afrika: Wenn die Ärmsten Flüchtlingen helfen
Hunderttausende sind im Grenzgebiet von Nigeria, Tschad und Niger auf der Flucht. Obwohl sie selbst arm sind, nehmen Bauern die Geflüchteten auf.
Die Fremden kamen an einem Montag. Es war noch früh, die Sonne stand tief – trotzdem brannte die Luft. Baï Baï Battit arbeitete auf seinem Feld, als er plötzlich das Knattern von Motoren hörte. Er rannte zum Ortseingang und sah vier Jeeps, auf den Ladeflächen ausgemergelte Menschen. Tagelang waren die Flüchtlinge durch die Wüste geirrt. Nun hatten sie Kabi erreicht, Battits Heimatort. Sie baten darum, bleiben zu dürfen.
Battits Dorf liegt im Grenzgebiet zwischen Niger und Nigeria; einer Gegend aus rotem Sand und flimmernder Hitze. Der Landstrich zählt zu den ärmsten der Welt. Doch der Hunger ist nicht die einzige Bedrohung. Seit einigen Jahren gilt die größte Sorge der Bewohner der islamistischen Terrorarmee Boko Haram, die ihren Ursprung in Nigeria hat und sich inzwischen ins Dreiländereck zwischen Nigeria, Niger und Tschad zurückgezogen hat. Dort plündert Boko Haram Dörfer, mordet und vertreibt Anwohner.
700 Menschen leben in Kabi. Die Ortschaft besteht aus Lehmhütten ohne Wasser, Strom oder Türen. Die Bewohner schlafen auf Bastmatten, die sie auf den Boden legen. Jede Familie besitzt ein kleines Feld nahe der Wasserquelle oder ein paar Ziegen. Meist reicht die Ernte gerade so. Doch nun standen die Flüchtlinge vor den Toren des Dorfes, und niemand wusste, was zu tun war. Sollte man die Menschen fortschicken und sie dem Tod in der Wüste überlassen? Oder sie aufnehmen, obwohl man sie eigentlich nicht mitversorgen kann?
Der Dorfchef rief alle Männer zusammen. Unter einem Strohdach berieten sie, wie zu verfahren war. Schließlich entschied das Oberhaupt: Die Flüchtlinge würden in Kabi bleiben. Man hoffte, dass Boko Haram bald besiegt wäre und die Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren könnten.
Mauern mit Stacheldraht
Drei Jahre ist das nun her. Die Ankömmlinge in Kabi waren nur Vorboten. Alleine in der Region, in der Battits Dorf liegt, kamen in den vergangenen Jahren 250.000 Menschen an. Diffa, die größte Stadt, ist voll mit Hilfswerken, Militär und Vertriebenen. Im Schatten der hellen Mauern dösen Mütter und Kinder, Ziegen und Schafe streunen durch die Gassen. Dazwischen Jeeps der UN, deren Fahrer hinter mit Stacheldraht verstärkten Mauern verschwinden.
Seit Boko Haram nach Niger vordringt, herrscht in Diffa der Notstand. Eine Ausgangssperre verbietet, sich nach 22 Uhr auf der Straße aufzuhalten. Autofahren ist schon am frühen Abend nicht mehr möglich, Motorräder nicht einmal am Tag erlaubt. So will Nigers Armee verhindern, dass Boko-Haram-Kämpfer unbemerkt in die Stadt eindringen.
Es nützt nichts: Seit Kurzem erreicht der Terror auch wieder Diffa. Zuletzt sprengten sich im Juni 2018 drei Selbstmordattentäter in die Luft. Sie mischten sich vor einer Moschee unter die Gläubigen, die gerade das Ramadan-Fasten brachen. Mindestens sechs Menschen starben bei der Explosion.
Der Anschlag ist Boko Harams Rache für eine Militäroffensive, die seit April in der Grenzregion läuft. Niger, Nigeria, Kamerun, Tschad und Benin haben sich zusammengeschlossen, um die Reste der Terrorgruppe zu bekämpfen. Unterstützt wird das von Frankreich, dessen Militär die afrikanischen Armee offiziell nur berät. Tatsächlich aber sieht man unweit von Diffa Panzer, auf deren Dächer Soldaten mit französischem Abzeichen Wache halten.
Man rückte zusammen
Die Offensive sorgt zunächst für noch mehr Leid. Weil sich die Terroristen auf Inseln im Tschadsee zurückgezogen haben, wurde das Gebiet vom Militär zur Sperrzone erklärt. Fischer können nicht mehr hinausfahren, der Paprikaanbau liegt brach. Stattdessen wird das Gelände bombardiert. Die Bewohner fliehen.
Dennoch gibt es in der Region Diffa nur ein einziges offizielles Flüchtlingslager. Es beherbergt mehr als 10.000 Menschen. Die meisten Vertriebenen haben inoffizielle Camps eröffnet oder in Dörfern Zuflucht gesucht. So wie in Kabi, dem Dorf von Battit.
Nach und nach kamen etwa 200 Flüchtlinge in Kabi an. Um sie zu versorgen, verkaufte jede Familie im Dorf ein oder zwei Ziegen. Man rückte zusammen, machte Hütten frei, teilte Felder und Wasser. Battit, der selbst neun Kinder und eine greise Mutter zu ernähren hat, nahm zwei Familien auf. Aus 12 Personen in seinem Haushalt wurden plötzlich 31, verteilt auf drei Lehmhütten, die Battit besitzt. Abends saßen alte und neue Bewohner gemeinsam am Feuer, und die Flüchtlinge erzählten, wie Boko Haram ihr Dorf umzingelte, zehn Männer erschoss und den anderen drohte: „Flieht, oder wir töten euch auch.“ Und so flohen sie.
Yamah kam im Frühjahr 2015. Der 38-Jährige ist eigentlich ein Einheimischer, er wurde in Kabi geboren. Doch weil die Ernte zu knapp ausfiel, hatte er sein Heimtatdorf vor sieben Jahren verlassen. Erst verdingte sich Yamah als Erntehelfer auf einer Paprikaplantage nahe des Tschadsees. Später fand er Arbeit als Bauarbeiter oder nähte Baumwollhemden. Nach zwei Jahren hatte er genug Geld gespart: Er konnte ein kleines Haus in Boulagana errichten, nahe der Grenze zu Nigeria, und seine Frau aus Kabi nachholen.
„Wenn Boko Haram sich rächt?“
„Wir hatten ein gutes Leben“, sagt Yamah. Bis Anfang 2015 Boko Haram in ihrer Gegend auftauchte. „Wir hörten, dass sie Dörfer überfallen, Essen und Geld rauben. Und manchmal bringen sie auch die Bewohner um.“ Mit jeder Woche kamen die Schreckensmeldungen näher. Dann überfiel Boko Haram den Nachbarort. „Die Bewohner haben dabei einen Kämpfer getötet“, erzählt Yamah. „Ich dachte: Was ist, wenn Boko Haram sich rächt?“ Aus Angst machte die Familie sich auf den Weg nach Westen: Yamah, seine Frau und die sechs Kinder. Die Kleinsten schob Yamah in einer Schubkarre. Haus und Habe ließen sie zurück.
Mehr als hundert Kilometer waren es bis nach Kabi. Dank einer Mitfahrgelegenheit kam die Familie in der Nacht im Dorf an. Sie schliefen im Haus von seinen Eltern, die in Kabi geblieben waren. Heute bewohnen Yamah, seine Frau und die inzwischen acht Kinder eine eigene Hütte. Das ist mehr Platz als die meisten Bewohner in Kabi haben: Viele Familien teilen sich ihren Wohnraum seit nunmehr drei Jahren mit den Neuankömmlingen. Die Kinder von Baï Baï Battit schlafen nachts dicht an dicht – in ihrem früheren Schlafzimmer wohnt eine Flüchtlingsfamilie. Es sollte ein vorübergehender Zustand sein. Doch Boko Haram verschwand nicht. Im Gegenteil: Immer mehr Flüchtlinge kamen.
Dorfchef Kabima Kolo
Nicht nur Schlafplätze werden geteilt. Auch an Essen und Feuerholz herrscht Mangel. Der Brunnen führt inzwischen weniger Wasser, weil mehr Menschen sich daran bedienen. Das Dorf kann nur überleben, weil die Welthungerhilfe die Bewohner finanziell unterstützt. Trotzdem, sagt Dorfchef Kabima Kolo, bezweifelt niemand, dass es richtig war, die Flüchtlinge aufzunehmen. „Es war Gottes Entscheidung, dass diese Menschen hierherkamen. Wir müssen seinen Willen respektieren.“
„Ich hoffe, dass das Militär Erfolg hat und Boko Haram vertreibt“, sagt Battit. „Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich es nicht.“ Viele Armeen hätten gegen Boko Haram gekämpft – erfolglos. „Vielleicht ist es unmöglich, sie zu besiegen.“
Die humanitäre UN-Koordinierungsstelle OCHA verspricht sich wenig von der Militäroffensive. Offizielle Kritik will man nicht äußern, aber ein hochrangiger Mitarbeiter sieht kaum Erfolge. „Trotz der Operation gehen die Angriffe von Boko Haram weiter“, sagt er. „Tagsüber tarnen sich die Kämpfer einfach als Bauern. Sie vergraben ihre Kalaschnikows und begrüßen lächelnd das vorbeifahrende Militär.“
Der Schaden für die Bevölkerung sei umso höher. „Fischerei und Paprikaanbau sind nicht mehr möglich“, sagt der UN-Mitarbeiter. Die Armut wächst – was wiederum Flüchtlinge dazu treiben könnte, sich Boko Haram anzuschließen. Denn bei aller Brutalität verspricht die Terrororganisation wenigstens ein Auskommen.
Es ist also nicht abzusehen, wann die Flüchtlinge in Kabi in ihre Dörfer zurückkönnen. Die Einheimischen wollen sie so lange unterstützen, wie es nötig ist. Die Hoffnung: Wir kümmern uns um die Notleidenden – und Gott verschont unser Dorf. Denn die Frontlinie ist nicht weit, Boko Haram könnte jederzeit auch in Kabi einfallen. „Wir haben keinen Schutz“, sagt Battit. „Wir können nur beten.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





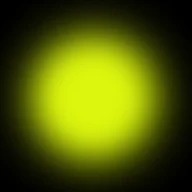


meistkommentiert