Spionageaffären in Deutschland: Agent Nummer Zwei
Nach dem Verdacht, es gebe im Bundestag einen weiteren Spion in Diensten der USA, platzt der Opposition der Kragen. Und der SPD auch.
BERLIN taz | Die Bundesregierung gibt sich zugeknöpft an diesem Mittwochmittag. Seit gut einer Stunde ist klar: Die Spionageaffäre der US-Geheimdienste in Deutschland erfährt eine erneute Wendung. Es gibt einen zweiten Verdachtsfall in Berlin, eine Wohnung und ein Büro im Verteidigungsministerium wurden durchsucht. Doch in der Regierungspressekonferenz hüllen sich die Vertreter der betroffenen Ministerien in größtmögliches Schweigen.
Steffen Seibert, Sprecher der Kanzlerin, spricht vage von einem „möglichen zweiten Fall“ – detaillierte Auskünfte könne er leider nicht geben. Nur so viel: Wenn sich bewahrheite, was an Vorwürfen im Raum stehe, wäre das ein „sehr ernster Vorgang“.
Sehr ernst – das scheint die offizielle Kategorie für das, was seit dem Morgen das politische Berlin in Atem hält. Auch der Sprecher des Verteidigungsministeriums verwendet diese Formulierung. Nur Informationen zu dem Vorfall will er keine preisgeben: Seit wann war Ministerin Ursula von der Leyen informiert? Wie kam der neue Spionageverdacht überhaupt ans Licht? Schweigen auf der Bank der Ministeriumssprecher.
Am Morgen hatten Beamte des Bundeskriminalamts und der Bundesanwaltschaft Wohn- und Büroräume eines Beschuldigten im Raum Berlin. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft bestätigte den Einsatz: Gegen den Mann bestehe ein „Verdacht der geheimdienstlichen Agententätigkeit“. Es seien Computer und Datenträger beschlagnahmt worden, die nun ausgewertet würden. Weiter äußerte sie die Behörde vorerst nicht.
Mutmaßlicher Auftrag eines US-Geheimdienstes
Laut Medienberichten soll der Auftraggeber erneut ein US-Geheimdienst gewesen sein. Demnach soll ein im Verteidigungsministerium angestellter Bundeswehrsoldat Militärinformationen weitergereicht haben. In welchem Umfang und über welchen Zeitraum blieb offen. Offenbar wurde der Informant vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) entdeckt, weil er in Kontakt mit Personen eines US-Dienstes gestanden haben soll.
Festgenommen wurde der Beschuldigte laut Bundesanwaltschaft zunächst nicht. Er wurde am Mittwochnachmittag noch verhört. Bereits am Donnerstag aber will die Regierung das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags, zuständig für die Geheimdienstaufsicht, über den Vorfall informieren.
Bemerkenswerte Koinzidenz: Just am Mittwoch, um 10 Uhr vormittags, fand sich der US-Botschafter John B. Emerson im Auswärtigen Amt zu einem Gespräch ein – auf Wunsch der US-Seite, wie das Ministerium betonte. Allerdings habe der Wunsch auf deutscher Seite ebenso bestanden, wenn es sich auch nicht um eine förmliche Einbestellung gehandelt habe.
Zweite Aussprache innerhalb einer Woche
Es war bereits die zweite Aussprache mit dem Botschafter zur Spionageaffäre innerhalb einer Woche – allein das rangiert weit außerhalb diplomatischer Normalität. Der Staatssekretär habe dem Botschafter „eindringlich klargemacht“, wie wichtig eine „aktive und konstruktive“ Mitwirkung der US-Regierung an der Aufklärung der im Raum stehenden Vorwürfe sei, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Zur Reaktion des US-Botschafters schwieg er.
Erst vor einer Woche hatte die Bundesanwaltschaft einen 31-jährigen BND-Mitarbeiter festgenommen, der seit Ende 2012 mehr als 200 Geheimdokumente an US-Geheimdienste weitergereicht hatte, darunter Papiere für den NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Die Empörung war groß. Den aktuellen Fall bewerten Insider nach Informationen der Süddeutschen Zeitung als „noch ernster“.
Merkels Sprecher äußerte sich am Mittwoch besorgt. Bei der Frage, wie Sicherheit und Freiheitsrechte in Einklang zu bringen seien, gebe es „tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten“, warnte Seibert. Das deutsch-amerikanische Verhältnis habe weiter große Bedeutung: „Aber diese tiefgreifende Meinungsverschiedenheit geht an das Vertrauen dieser Partnerschaft.“
Blanke Empörung unter Parlamentariern
Unter Parlamentariern schlug die Stimmung in blanke Empörung um. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sprach von einem „entwürdigen Schauspiel“. „Ich rate den Amerikanern, jetzt reinen Tisch zu machen, alles offenzulegen und die Spionageaktivitäten einzustellen.“ Die USA sollten „Acht geben“, dass das Vertrauen in sie „nicht komplett einstürzt“.
Die Opposition attackierte die Bundesregierung. Linken-Fraktionsvize Sahra Wagenknecht forderte, „mit der Logik der Geheimdienste zu brechen und die deutschen Dienste aufzulösen“.
Diesmal scheint der Ärger in den USA anzukommen. Bereits am Dienstag soll CIA-Chef John Brennan mit dem Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, Klaus-Dieter Fritsche, telefoniert haben – ein Versuch des Appeasements. Auch über das Gespräch wurde Stillschweigen vereinbart. Da allerdings war der erneute Spionagefall noch nicht bekannt. Nun wird Fritsche wohl erneut telefonieren müssen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









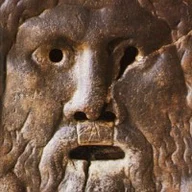



meistkommentiert
CSD-Absage der Bundestagsverwaltung
Klöckner macht Kulturkampf
Analyse zum Krieg zwischen Iran & Israel
Drehbuch mit offenem Ende
Queere Sichtbarkeit
Bundestagsgruppe darf nicht zum CSD
Die SPD und die Rüstung
Heiße Eisen
Rassismus gegen Muslime in Deutschland
Diskriminierung, Gewalt, tödliche Angriffe
G7-Gipfel in Kanada
Trump reist von G7 ab und beleidigt Macron