Reportage über coole Rechte: Eingeweihte unter sich
Die Reportage im „Zeit-Magazin“ liest sich, als habe Gramsci das Drehbuch geschrieben. Die Rechte strebt nach Hegemonie durch ehemals linke Praktiken.

D ieser Tage erschien im Zeit-Magazin eine verstörende Reportage über eine neue Kulturszene. Ausgerechnet in Manhattan habe sich eine junge, Trump-affine „Boheme“ gebildet – konnte man da erfahren. Wie konnte das geschehen?
„Wie wurde rechts cool?“, fragt die Autorin. Es mag ein erstaunliches Genre sein, eine Reportage zu kommentieren. Aber was hier über viele Seiten beschrieben wird, liest sich. als ob Antonio Gramsci das Drehbuch dazu geschrieben hätte.
Für den kommunistischen Theoretiker bedeutet Hegemonie – also ideologische Vorherrschaft – nicht einfach Dominanz durch Inhalte, Überzeugungen, Weltanschauungen. Hegemonie muss vielmehr ganz materiell errungen werden: in Institutionen. Durch ein bestimmtes Personal. Mit spezifischen kulturellen Praktiken.
Die neuen Kultur-Trumpisten folgen dem in allen Punkten. Als sei es ihre Anleitung. Sie haben ihre eigenen Institutionen und Medien entwickelt. Diese reichen von klassischen Formen wie Texten, Literatur, Theaterstücken und den entsprechenden Institutionen wie Verlage, Zeitungen bis hin zu neuen Formen wie Podcasts und Filmfestivals. All das bildet das Grundgerüst einer hippen rechten Gegenkultur von jungen Trump-Aficionados.
Schicke Leute
Hier, beim Personal dieser Kulturszene, liegt die vielleicht größte Merkwürdigkeit. Dieses rekrutiert sich nicht aus den Abgehängten, den Arbeitslosen, der verlassenen weißen Arbeiterklasse, nicht aus jenen, die Hillary Clinton einst so denunzierend als deplorables bezeichnet hatte. Es ist also nicht die erwartete MAGA-Basis, die sich hier versammelt.
In Manhattan formieren sich vielmehr schicke Leute – junge Schriftsteller, Künstler – zu dem, was eine doch unerwartete intellektuelle Gegenkultur ist. Das Erstaunliche daran ist, dass sie sich auch als solche verstehen wollen. Rechts ist für sie nicht gleichbedeutend mit Antiintellektualismus.
Und wie immer in solchen Szenen gibt es auch hier zentrale Figuren, die ebendarum im Zentrum stehen, weil sie die dazugehörenden Mythen verkörpern. In dem Fall etwa der Blogger Curtis Yarvin, Proponent einer „dunklen Aufklärung“.
Die Praktiken dieser Szene lassen sich an vier Verben festmachen: schreiben, lesen, reden, tanzen. Etwa bei DOGE-Partys. Bei alledem geht es darum, sich gemeinsam als rebellisch zu erleben. Dazu dienen alle möglichen Strategien. Etwa die Orte für Veranstaltungen geheim zu halten – so dass sich dort nur Eingeweihte treffen. Vor allem aber das alterprobte Mittel des Tabubruchs.
Dieser reicht von der verpönten Zigarette – hier raucht man wieder – bis zur inhaltlichen Provokation. In diesem Fall bedeutet das: Man verständigt sich aufs Anti-Woke, aufs inkorrekte Sprechen, auf die Ablehnung von MeToo oder auf einen „ehrlichen“ Rassismus.
Konzepte der Subkultur
All das befestigt eine Szene, ein Milieu, bildet eine Gegen-Gemeinschaft gegen die vorherrschende Kultur. (Auch wenn das rebellische Moment angesichts von Trumps Wahlsieg nunmehr fraglich wird und etwas ins Stocken gerät.) All das ist aber ein Déjà-vu. Von den großen Strategien bis hin zu den kleinen Verhaltensweisen – von der Schaffung einer Gegenöffentlichkeit bis zur lässigen Zigarette im Mundwinkel. All das wurde schon gesehen. Zu einem anderen Zeitpunkt – in ganz anderen Kontexten. Nämlich 1968.
Was man hier wieder sieht, sind ehemals linke Strategien, linke Rebellionsformen, die genau zu dem geworden sind – zu reinen Formen. Nunmehr dienen diese Formen einem Aufbegehren gegen links. Nunmehr werden sie mit rechten Inhalten aufgefüllt. Das Konzept der Subkultur ebenso wie das der Coolness wird beibehalten. Sie lassen sich nahtlos übernehmen. Grenzüberschreitungen und Regelbrüche funktionieren auch von rechts.
All das, was einmal linke Politikkultur war, wird beliebig anwendbar. Man könnte auch sagen: Es wird zur Pose. Nichts zeigt den rechten Hegemonievorsprung deutlicher als diese kulturell-politische Aneignung: Trumpismus als Weltgefühl. Als hipper Lifestyle.
Und so war es gewissermaßen folgerichtig, wo diese Reprotage erschienen ist: im Zeit-Magazin für Lebensart.
Die Autorin ist Publizistin in Wien.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






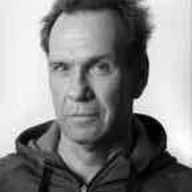
meistkommentiert